|
Dienstag, 8. Mai 2007
UMZUG Nach knapp 2000 Tagen bei antville und blogger machen wir ab jetzt woanders weiter. Unter der neuen Adresse http://www.newfilmkritik.de sind alle Einträge seit November 2001 zu finden. Großer Dank an antville! Großer Dank an Erik Stein für die technische Unterstützung! filmkritik, 8. Mai 2007 um 15:10:45 MESZ ... Link Sonntag, 22. April 2007
Warum ich keine „politischen“ Filme mache. von Ulrich Köhler Ken Loachs „Family Life“ handelt nicht nur von einer schizophrenen jungen Frau, der Film selbst ist schizophren. Grandios inszeniert zerreißt es den Film zwischen dem naturalistischen Genie seines Regisseurs und dem Diktat eines politisch motivierten Drehbuchs. Viele Szenen sind an psychologischer Tiefe und Vielschichtigkeit kaum zu überbieten – in den Beratungsgesprächen zwischen dem Therapeuten und der Familie etwa entstehen aus der Freiheit und Spielfreude, die Loach seinen Darstellern lässt, extrem glaubwürdige Szenen. Doch leider zerstört das Drehbuch mit seiner politischen Zielsetzung alle innerszenische Schönheit wieder. Für Offenheit, Ambivalenz und Komplexität lässt es keinen Raum. Gut und Böse müssen am Ende eindeutig verteilt werden. Auf das Ganze betrachtet, interessiert sich der Film nicht für das individuelle Schicksal seiner Figur. Sie ist für den Autoren ein typischer Fall, ein Platzhalter der Dramaturgie. Der gute Gesprächstherapeut verliert seinen Job und die Gerätemediziner mit ihren Elektroschocks zerstören die zarten Erfolge einer fortschrittlichen Therapie, die nach den sozialen Ursachen der Krankheit fragt. Das Mädchen wird nach einem Ausbruchsversuch eingefangen und unter Zwang in eine geschlossene Anstalt eingewiesen. Das letzte Bild zeigt uns einen gebrochenen, willenlosen Menschen, der zwar seinen Eltern keine Schwierigkeiten mehr bereiten wird, der aber alles verloren hat, was wir als seine Würde ansehen. Das Problem des Films ist nicht die Glaubwürdigkeit der Geschichte - so etwas könnte sich zugetragen haben -, es ist das schale Gefühl, einzig deshalb auf diese emotionale Butterfahrt geschickt worden zu sein, um eine Botschaft zu kaufen: Psychosen sind das Produkt repressiver Familienstrukturen und einer technokratischen Psychiatrie. Hinter dem Naturalismus des Spiels versteckt sich vor allem diese These. Ich als Zuschauer spüre die politische Dramaturgie und fühle mich betrogen. Gerade Loachs Naturalismus verstärkt dieses Gefühl noch. Wäre der Film offen didaktisch wie ein Brechtsches Drama oder würde er wie Bresson in „L’Argent“ seine dramaturgische Kausalkette nicht verstecken, hätte ich dieses Gefühl nicht. „L’Argent“ ist sicher nicht Bressons bester Film. Die soziale Mechanik, mit der hier das kapitalistische System einen Mensch erst in die Armut und dann schrittweise von der Kleinkriminalität zum Mord treibt, ist mir zu einfach. Aber der Film versteckt seine monokausale Argumentationskette nicht hinter einer quasi dokumentarischen Fassade und täuscht mich nie über seine Absichten. Die Form ist eben auch politisch. Sie verrät viel über die Haltung des Filmemachers gegenüber Figuren und Zuschauern. Bei Loach bin ich viel mehr mit der Frage nach der „Wahrscheinlichkeit“, nach dem Realitätsgehalt des Dargestellten beschäftigt als mit der Frage, wie psychische Krankheiten mit sozialen Verhältnissen zusammen hängen und was wir tun können, um sie zu ändern. Damit ist der Film nicht nur künstlerisch sondern auch politisch gescheitert. Traurig zu sehen, wie der grandiose Schauspielregisseur Loach die Komplexität der Welt immer wieder einem politischen Programm opfert. Es sind die eigenen moralischen Ansprüche, die ihn in diese Falle treiben. Das Schlussbild dieses Films soll die Zustände des Systems anprangern, es prangert aber vor allem den Film selbst an: die Hauptfigur ist nicht Opfer der Psychiatrie, sie ist Opfer der Instrumentalisierung durch den Film. In meinen Augen schadet diesem Film die Vermischung politischer und künstlerischer Motive sehr, sie schadet ihm künstlerisch und politisch. Das traurigste Konzert meines Lebens war ein Auftritt von Stefan Remmler im Cafe „schöne Aussichten“ in Hamburgs „Planten und Blomen“. 15 Jahre nachdem er mit Trio und „Dadada“ den deutschen Schlager revolutioniert hatte, singt er „Mein Freund ist Neger“ vor ein paar älteren Damen. Alles ist politisch. Das stimmt vielleicht. Aber die Unterscheidung zwischen künstlerischer und politischer Praxis ist sinnvoll. Politik gestaltet das Zusammenleben der Menschen. Politisches Handeln will die Gesellschaft verändern oder vor Veränderungen bewahren. Kunst hat keine allgemeingültig definierbare gesellschaftliche Funktion. Jeder Künstler muss die Frage für sich selbst beantworten können. Politisches Handeln ist funktional. Ich verteile Handzettel, damit Menschen Müll trennen oder ich schmeiße Bomben, um die Machtverhältnisse umzuwerfen. Instrumente politischen Handelns haben keinen Wert an sich, sie haben ihren Wert in Hinblick auf ihr Ziel. Ich kann Menschen mit Argumenten oder mit Faustschlägen davon überzeugen, den Joghurtbecher in die gelbe Tonne zu werfen. Beides sind politische Instrumente. In der Funktionalität liegt der entscheidende Unterschied zwischen politischer und künstlerischer Praxis. Kunstwerke sind nicht Mittel zum Zweck. Kunst taugt nicht zur Beruhigung des politischen Gewissens. Ein Gegenbeispiel zu „Family Life“ ist „Titicut Follies“ von Frederick Wiseman: ein Dokumentarfilm über eine forensische Anstalt in den USA Ende der 60er Jahre. Wiseman schaut hin, verzichtet auf Offkommentare und eine Dramaturgie, die am Schicksal einer Figur aufgehängt ist. Sein Portrait einer Institution braucht keine identifikatorische Erzählung mit Protagonisten und Antagonisten. Psychiater und Pfleger in seinem Film verhalten sich vielfach brutaler und unmenschlicher als das Personal der Anstalt in Loachs Film, und doch bleibt jeder der Protagonisten ein komplexer Mensch. Der Regisseur ist nicht mit einem vorgefertigten Erzählziel an die Arbeit gegangen - auch wenn er sicher eine Ahnung davon hatte, was ihn in dieser Anstalt erwarten würde. Er untersucht seinen Gegenstand. Ich habe das Gefühl, diesen Ort zusammen mit dem Regisseur kennen zu lernen und nicht eine vorverdaute Lektion erteilt zu bekommen. Wiseman vertraut meiner Urteilsfähigkeit. Natürlich ist auch dieser Film ein subjektiv gestaltetes Werk, in dem der Autor auswählt, was er mir zeigt und was nicht. Aber er hat sich von dem leiten lassen, was er gefunden hat und nicht von dem, was er von vornherein beweisen wollte. Das ist die künstlerische Logik und politische Ethik von Wisemans Film. Bei ihm macht die Unterscheidung zwischen politischer und künstlerischer Praxis vielleicht keinen Sinn mehr. Vielleicht aber doch: Aus der Konsequenz und Kompromisslosigkeit, mit der Wiseman gesellschaftliche Zustände dokumentiert, entsteht auch ein künstlerischer Film. Seine Arbeit ist aber vor allem politisch motiviert. Sie gewährt der Gesellschaft Einblicke in Institutionen, die sie geschaffen hat und gibt ihr so die Möglichkeit, über sich selbst nachzudenken und sich zu verändern. Wenn es ein politisches Kino geben soll, dann muss es so aussehen. Wisemans Film hat seine Wirkung nicht verfehlt. Das beweist allein schon der gerichtlich erzwungene Hinweis im Abspann, dass sich die Zustände in dieser Institution seitdem geändert haben. Beim Vergleich beider Filme stelle ich mir die Frage, ob bestimmte Themen überhaupt mit der dramaturgischen Logik des Spielfilms vereinbar sind. Die Schwemme unsäglicher Filme zur deutschen Geschichte in den letzten Jahren verstärkt diese Zweifel.(1) Die staatliche Kulturförderung liebt Filme, die politische Aufklärung in Geschichten „verpacken“. Der Bürger soll schließlich nicht überfordert werden. Auf der Verpackung steht dann zum Beispiel: die bewegende Liebesgeschichte zwischen einem türkischen Mädchen und einem Skinhead. Filmemachen als Verpackungskunst. Das ist das ästhetische Programm sozialdemokratisierter Kulturpolitik. Kulturproduzenten wissen, dass sie Geld nachgeworfen kriegen für Projekte gegen Rassismus, Nationalsozialismus, die Unterdrückung von Minderheiten oder die Armut in fernen Ländern. Politische Bildung und Kultur aus einem Topf. Ich muss mir nur die Liste geförderter deutscher Filme anschauen oder Hakenkreuze im zeitgenössischen Kino und Fernsehen zählen. Diese Politik überfordert die Kunst und unterfordert die Intelligenz ihrer Bürger. Sie macht den Künstler unfrei und den Zuschauer unmündig. Sie produziert einen Berg künstlerisch wertloser, klischeebeladener Filme, die politisch wirkungslos sind. Schlimmer noch: abgesehen davon, dass einige dieser Werke revanchistisch sind, fördern sie gesellschaftlichen Stillstand, indem sie den sowieso schon einverstandenen Bürgern das Gefühl geben Gutes zu tun, wenn sie „politische“ Filme oder Theaterstücke konsumieren. Marlen Haushofer schreibt über de Sicas „Fahrraddiebe“: „Die Träne in Frau Müllers Auge bringt keinem armen Teufel sein Fahrrad zurück und verschafft nur Frau Müller die Illusion, ein guter Mensch zu sein. Diese Illusion ist abzulehnen.“ Die gesellschaftlichen Ressourcen, die in so genannten politischen Filmen stecken, lassen sich effizienter einsetzen. Meistens sind die Trailer politischer als die Filme selbst. Warum machen wir dann noch die Filme? Ein gezielter Farbbeutelwurf oder ein „Bild“-Schlagzeile richtet sowieso mehr aus. Die Qualität eines Films wird nicht an seiner politischen Wirkung gemessen, aber ein so genannter politischer Film müsste sich daran messen lassen. Das vordergründige Thematisieren politischer Inhalte beruhigt vielleicht das Gewissen, politisches Handeln ist das noch lange nicht. Was ist das Politische an einem Film, der die Welt nicht verändern kann und will? Was ist das Politische an „politischer“ Kunst? Neben den Zweifeln an der Wirksamkeit darf in vielen Fällen auch an der Integrität des Anliegens gezweifelt werden: „Politische“ Werke führen häufig ein Nischendasein und erreichen so wenige Menschen, dass sie wirkungslos bleiben müssen. Nur der Kunstmarkt hält sie am Leben. Die politischen Ziele des Künstlers geraten schnell in Widerspruch zu den Mechanismen des Marktes. Werke, die ein größeres Publikum erreichen, fördern ein anderes Dilemma zu Tage: Sie vermarkten sich als politisch und subversiv, aber Erfolg und Rezeptionskonsens beweisen eher das Gegenteil und sind ein ziemlich gutes Indiz für ihren affirmativen Charakter. Ist die Akzeptanz so groß, darf am subversiven Potential gezweifelt werden. Kunst, die nur Kunst sein will, ist häufig subversiver. Welche Sammlungen schmücken sich mit Werken politischer Künstler wie Hans Haacke? Wie provozierend ist ein „Provokationskünstlers“ (Selbstbeschreibung auf seiner Website), der Wagner in Bayreuth inszenieren darf? Wie beißend kann die Kapitalismuskritik eines „politischen Feelgoodmovies“ (Pressezitat aus der Filmwerbung) sein, wenn es den bayerischen Staatspreis, die Konsens-Lola und das Wohlwollen des gesamten politischen Spektrums gewinnt? Sind wir Oscar? Die Logik des Politischen ist verschieden von der Logik des Künstlerischen. Politik verlangt verantwortungsvolle Kompromisse, Kunst darf kompromisslos und amoralisch sein. Wer dies nicht sieht, schafft in der Regel weder künstlerisch noch politisch Interessantes. Kunst ist kein Mittel zum Zweck. Sie ist nicht ergebnisorientiert. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Kunst, die in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, zeichnet sich durch ihre Offenheit, durch ihre Mehrdeutigkeit, durch ihre Amoralität und ihre Weigerung aus, sich instrumentalisieren und funktionalisieren zu lassen. Wenn Kunst politisch ist, dann ist sie genau darin politisch: Sie wehrt sich dagegen (tages)politisch und gesellschaftlich verwertbar zu sein. Ihre Stärke liegt in ihrer Autonomie. Auch wenn diese eine Illusion sein mag - jedes Kunstwerk ist auch Produkt eines Marktes - so ist sie doch eine notwendige Utopie für den Künstler. Es geht mir nicht darum ideologische Trennlinien zu ziehen: Hoch- vs. Trivialkultur, Kommerz vs. Kunst, U vs. E, politische Aufklärung vs. Filmkunst, Reportage vs. Literatur. Es gibt viele Beispiele im Pop, im Design, in der Architektur, im Film usw., die sich nicht am Ideal eines autonomen Kunstwerks orientieren und die dennoch wichtige Kulturgüter sind. Politische Aufklärung ist wichtig, aber die Unterscheidung verschiedener Formen kultureller Praxis ist es auch. Ein künstlerischer Filmemacher ist kein Sozialpädagoge oder Historiker (und ein kommerzieller Regisseur übrigens auch nicht). Der Aufklärer muss sich fragen, ob Spielfilme, Romane und Theaterstücke wirklich geeignete Instrumente seiner Arbeit sind. Wählt er diese Instrumente, ist die Politik der Formen entscheidend. Also ja, alles kann Kunst sein: politische Aufklärung kann Kunst sein, Funktionales kann Kunst sein, Pop kann Kunst und politisch sein und Kunst kann politisch sein - aber Kunst, die politisch sein will, ist meistens weder das eine noch das andere. Derjenige, der einer bestimmten Praxis nachgeht, sollte den Zielen seines Handelns treu bleiben. Ist er darin konsequent und erfinderisch, schafft er etwas Neues, macht es vielleicht wieder Sinn von Kunst zu reden. So ist zumindest der Sprachgebrauch. Aber wer einen Stuhl entwirft, will zunächst einmal eine Sitzgelegenheit schaffen und wer die Gesellschaft verändern will, muss politisch handeln.(2) Noch ein Beispiel aus der Filmgeschichte: Mit „Shoah“ wollte Lanzmann ein Kapitel der Geschichte vor dem Vergessen bewahren. Sein Motiv ist politisch, seine Arbeit journalistische und historische Recherche. Die Konsequenz dieser Arbeit, sein Vertrauen in die Kraft der Zeugnisse, der Verzicht auf Pädagogik, die Tatsache, dass er sich als Autor nicht versteckt, haben aus dieser politischen Dokumentation über das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte ein Kunstwerk gemacht, das das Bild des Menschen für immer prägen wird. Steven Spielberg hingegen hatte zu viele sich widerstreitende Absichten: künstlerische, politpädagogische und kommerzielle. Das Ergebnis ist ein Geschichtsporno, der politisch das Gegenteil von dem bewirkt, was er bewirken will. Anstatt aufzurütteln, schläfert er ein, anstatt Rassismus zu bekämpfen, verfestigt er Vorurteile (das Casting!). Spielberg verharmlost die Geschichte und hat wohl eine der widerwärtigsten Szenen der Filmgeschichte geschaffen: eine Gaskammerszene, die gleichzeitig Porno und Betroffenheitsdokument sein will. Künstler sind Teil der Gesellschaft, in der sie leben. Kunst ist nicht politisch unschuldig. Künstler, die das ignorieren, sind entweder naiv oder reaktionär. Aber es ist etwas anderes, von Künstlern politisches Bewusstsein zu erwarten, als zu fordern, dass sie "politische" Kunst machen. Wer sich seine künstlerische Arbeit als eine politische schönredet, gerät leicht in unauflösbare Widersprüche. Er belügt sich und andere. Das zeitgenössische Kino beutet die deutsche Geschichte aus und ist dabei bestenfalls unpolitisch, häufig reaktionär. Exportweltmeister dank Hitler und der Stasi. Filbinger und Söhne feiern unterstützt von revisionistischen Eventmovies ein Revival. Und mit dem Oscar sind jetzt auch die ostdeutschen Volksmassen rehabilitiert. Der kleine Mann (der klein genug ist, den Konflikt mit seiner todkranken Exfrau für die Promotion seines Films auszuschlachten) ist von aller Schuld rein gewaschen. Das vereinte Deutschland kann jetzt brüllen: Wir waren es nicht, Hitler und Mielke sind es gewesen. Ein Kino, das sich an der Ausschlachtung der Geschichte nicht beteiligen will, ist noch lange nicht politisch ignorant. (3) Ich frage mich, warum eine Filmkritik, die sich ein politischeres Kino wünscht, nicht politischere Texte schreibt. Würde sie genauer hinschauen, würde sie vielleicht sehen, dass auch Filme, die sich nicht als Instrument politischer Bildung verstehen, politisch sein können. Sind Andreas Dresens lustige Kleinbürger politischer als Angela Schanelecs verunsicherte und verlorene Bildungsbürger, oder beschäftigt sich der Bildungsbürger lieber mit „den Anderen“, als sich zu fragen, was er selbst eigentlich auf dieser Welt verloren hat? Bevor die Filmkritik grüne Punkte an politische Filme verteilt, sollte sie ihre ästhetischen Kriterien überprüfen. Es ist schon eine Menge Arbeit, die innere Kohärenz von Filmen zu untersuchen. Ich vermute, dass dadurch mehr über die „Politik“ eines Films zu erfahren ist, als durch das vordergründige Abscannen nach politischen Inhalten. Vielleicht steckt ja hinter der Kritik an uns „unpolitischen“ Filmemachern der Vorwurf, wir entwickeln uns künstlerisch nicht weiter, weil wir uns nicht genug in Frage stellen. Dafür hätte ich mehr Verständnis. Aber das ist eine Kritik, die konkrete Auseinandersetzung mit einzelnen Filmen verlangt. Sie ist sicher interessanter als das pauschale Reden über Schulen, die es so nicht gibt. Die „Demoiselles d’Avignon“ waren subversiv, „Guernica“ ist ein schlechtes Bild. „Starship Troopers“ ist ein Antikriegsfilm, „Saving Private Ryan“ reaktionärer Dreck. Madonna ist Feministin und Alice Schwarzer die Mutter der Nation. Ein Fußballstadion voller Skins, die „Go West“ singen, ist schwuler als Rosa von Praunheim. Das Victoryzeichen von Josef Ackermann ist demokratiefeindlicher als die Grußbotschaft von Christian Klar an die Rosa-Luxemburg-Konferenz. Claus Peymann ist eine arme Sau. Die gelbe Tonne ist Kunst. (1) War der reale Hitler nicht schlimm genug? Wofür brauchen wir seine fiktiven Doppelgänger? Sein Regime hat Millionen Opfer gefordert, und trotzdem setzen sich Drehbuchautoren hin und denken sich neue aus. Jeder Autor ist dramaturgischer Folterknecht, das stimmt. Aber angesichts realen Schreckens dieses Ausmaßes kommt es mir komisch vor, am Schreibtisch zu sitzen und mir neues Leid für meine fiktiven oder (schlimmer noch) semi-historischen Figuren auszudenken. Um mit Godard zu argumentieren: Können wir zulassen, dass Spielberg Auschwitz neu aufbaut? Ein dokumentarischer Ansatz überzeugt mich da mehr. Wie immer Ausnahmen: Sokurov, Pasolini, Lubitsch... (zurück) (2) Eine so persönliche Filmemacherin wie Angela Schanelec zu fragen, warum sie keinen Film über den Fall der Mauer macht, ist ähnlich ignorant, wie Frieda Grafe zu fragen, warum sie nicht Gerichtsreportagen statt Filmkritiken schreibt. (zurück) (3) Vielleicht hilft der Blick auf die politischen Biografien von „unpolitischen“ Minimal-Künstlern wie Richard Serra oder einer Autorin von bürgerlichen Familienromanen wie Natalia Ginzburg. (zurück) pburg, 22. April 2007 um 13:36:03 MESZ ... Link Dienstag, 3. April 2007
Nach einem Film von Mikio Naruse Man kann darauf wetten, dass in einem Text über Mikio Naruse früher oder später der Name Ozu zu lesen ist. Also vollziehe ich dieses Ritual gleich zu Beginn und schreibe, nicht ohne Unbehagen: Ozu. Sicher, beide arbeiteten für dasselbe Studio. Sicher, in den Filmen Naruses kann man Schauspieler wiedersehen, mit denen man in den Ozu-Filmen Freundschaft geschlossen hat, in „Meshi“ von 1951 etwa Setsuko Hara und Haruko Sugimura, die ihre Mutter spielt . Sicher, viele Filme Ozus und Naruses werden dem Shomingeki zugerechnet und interessieren sich für den Alltag und die Normalität, nicht für das Drama und den Ausnahmezustand. Aber auf ähnliche Weise könnte man Filme von Hawks und Ford nebeneinander stellen und mit staunendem Zeigefinger sagen: Hier: John Wayne. Hier: Western. Insofern versperrt der Ozu-Vergleich vielleicht den Zugang zu dem, was an Naruse interessant ist und worüber ich nach dem ersten Film der kleinen Naruse-Reihe nur mutmaßen kann. Jedenfalls kommt es mir vor, als müsste der Name Ozu im Zusammenhang mit Naruse in Form einer Frage formuliert werden, die etwas Ungeklärtes markiert; nicht als Antwort, die seinen Filmen einen Platz zuweist. Die immer wieder benannte Nähe zu Ozu ist nachvollziehbar, aber auch erstaunlich, denn die wenigsten Einstellungen in „Meshi“ könnte man sich in einem Film von Ozu vorstellen. Es ist eine andere, weniger rechtwinklige Geometrie, die hier am Werke ist, sowohl in den einzelnen Bildern als auch in der dramaturgischen Architektur des gesamten Films. Naruse scheint sich eher treiben zu lassen und im Verlauf eines Films stärker auf die Bewegungen seiner Figuren zu reagieren. Wer Ozu im Hinterkopf hat, kann dies als nachlässig oder weniger konsistent empfinden; es zeigt aber mit gleichem Recht eine Offenheit für all das, was trotz oder gegen einen vorher vielleicht gefassten Entschluss in die Kamera einströmen kann. So gibt es in „Meshi“ zwei Einstellungen, die keiner der Figuren zuzuordnen sind, aber auch nicht unbedingt einem Erzähler (Erzählerin des Films aus dem Off ist in drei wichtigen Phasen des Films Michiyo Okamoto, die ihren Mann verlässt und eine Weile bei ihrer Mutter und den Geschwistern in Tokio lebt). In beiden Einstellungen ist jeweils eine belebte Straße zu sehen, eine davon ist mit Sicherheit in Osaka, das die überraschend vor der Heirat zum verwandten Ehepaar geflohene Nichte mit ihrem Onkel Osaka besichtigt. Ob die andere Einstellung etwas Entsprechendes in Tokio zeigt, weiß ich nicht mehr. Durch die starke Bindung der Kamera an Michiyo und die anderen Hauptfiguren ist man geneigt, auch diesen Blick einer dieser Figuren, dem Ehemann oder der Nichte zuzuschreiben. Die Kamera bewegt sich aber ganz autonom in den von der Straße eröffneten Bildraum hinein, sie schwankt dabei sogar ein bisschen, so dass man denken könnte, es sei eine Subjektive. In der Einstellung taucht allerdings keine der uns vertrauten Figuren auf; mein Gedanke war deshalb, dass es sich um Material aus dem Fundus des Studios handeln könnte, um eine anonyme Stadtansicht. Aber dass diese Bilder in diesem Film sind, verändert seine Erzählung. Ihre seltsame Unangebundenheit hebt die Erzählung aus dem Individuellen in eine jedenfalls angedeutete Allgemeinheit, die nicht die der anthropologischen Aussagen ist, sondern viel mit der japanischen Nachkriegsgesellschaft zu tun hat. Durch das Einfache, Alltägliche hindurch, an seinen Rändern ist in Naruses Film ein erstaunliches Nachkriegsjapan erkennbar, das permanent in es hineinwirkt. Das ist kein „gesellschaftlicher Hintergrund“, das sind keine „Ausflüge ins Soziale“; es scheint eher die Grundierung der gesamten Erzählung zu sein, etwas, das sie einfärbt, nicht erklärt. Ich will nur ein paar Szenen beschreiben, die mir aufgefallen sind, weil sie auf die ambivalente Präsenz der Amerikaner und überhaupt auf die Nachwirkung des gerade sechs Jahre zurückliegenden Krieges hindeuten.
Ich stelle mir die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg in Japan als eine maßlos verwirrende Zeit vor. Man muss sich ja die Ungeheuerlichkeit ins Gedächtnis rufen, dass der Abwurf der Atombomben gerade so lang zurücklag wie heute der Übergang von 1999 nach 2000. Michiyo sagt einmal, dass nach der Zerstörung Tokios nur flache Gebäude gebaut worden seien. Das Geld, die Spekulationen, die Orientierung auf Wiederaufbau und Reichtum, sind dem Film allerorten anzumerken; Osakas Finanzstraße wird von der Stadtführerin nicht ohne Stolz als „Gegenstück zur Wall Street“ bezeichnet. Diese Zerrissenheit zwischen Zerstörung und Wiederaufbau, zwischen Armut und Spekulation scheint mir eine Struktur zu benennen. Am Schluss, Okamotos Frau ist immer noch in Tokio, ihr Mann in Osaka und die Trennung dauert nun schon eine ganze Weile, bricht ein Sturm los. Die Leute bringen sich in den Häusern in Sicherheit, auf der Tonspur ist das Pfeifen des Windes zu hören. Am nächsten Morgen bessert jemand das Dach aus. Dieser Sturm, den man als Kinozuschauer liebend gern allegorisch verstehen würde, als Aufruhr in Michiyos Herzen, als Zuspitzung des Konflikts zwischen beiden, ist all das genau nicht. Er ist einfach nur das: ein Wind, der vorüberzieht. Volker Pantenburg pburg, 3. April 2007 um 22:53:52 MESZ ... Link Nächste Seite |
online for 8842 Days
last updated: 10.04.14, 10:40  Youre not logged in ... Login

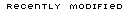 Danièle Huillet – Erinnerungen, Begegnungen
NICHT VERSÖHNT (1965) *** Jean-Marie Straub – Danièle und ich sind uns im November 1954 in Paris begegnet – wir erinnern uns gut daran, weil das der Beginn der algerischen Revolution war. Ich war mehrmals per Autostop nach Paris gekommen, um Filme zu sehen, die es bei uns nicht gab, LOS... by pburg (05.10.07, 11:58)
UMZUG
Nach knapp 2000 Tagen bei antville und blogger machen wir ab jetzt woanders weiter. Unter der neuen Adresse http://www.newfilmkritik.de sind alle Einträge seit November 2001 zu finden. Großer Dank an antville! Großer Dank an Erik Stein für die technische Unterstützung! by filmkritik (08.05.07, 15:10)
Warum ich keine „politischen“ Filme mache.
von Ulrich Köhler Ken Loachs „Family Life“ handelt nicht nur von einer schizophrenen jungen Frau, der Film selbst ist schizophren. Grandios inszeniert zerreißt es den Film zwischen dem naturalistischen Genie seines Regisseurs und dem Diktat eines politisch motivierten Drehbuchs. Viele Szenen sind an psychologischer Tiefe und Vielschichtigkeit kaum zu überbieten – in... by pburg (25.04.07, 11:44)
Nach einem Film von Mikio Naruse
Man kann darauf wetten, dass in einem Text über Mikio Naruse früher oder später der Name Ozu zu lesen ist. Also vollziehe ich dieses Ritual gleich zu Beginn und schreibe, nicht ohne Unbehagen: Ozu. Sicher, beide arbeiteten für dasselbe Studio. Sicher, in den Filmen Naruses kann man Schauspieler wiedersehen, mit denen... by pburg (03.04.07, 22:53)
Februar 07
Anfang Februar, ich war zu einem Spaziergang am späten Nachmittag aufgebrochen, es war kurz nach 5 und es wurde langsam dunkel, und beim Spazierengehen kam mir wieder das Verhalten gegenüber den Filmen in den Sinn. Das Verhalten von den vielen verschiedenen Leuten, das ganz von meinem verschiedene Verhalten und mein... by mbaute (13.03.07, 19:49)
Berlinale 2007 – Nachträgliche Notizen
9.-19. Februar 2007 Auf der Hinfahrt, am Freitag, schneite es, auf der Rückfahrt, am Montag, waren die Straßen frei und nicht übermäßig befahren. Letzteres erscheint mir angemessen, ersteres weit weg. Dazwischen lagen 27 Filme, zwei davon, der deutsche Film Jagdhunde, der armenische Film Stone Time Touch, waren unerträglich, aber sie lagen... by filmkritik (23.02.07, 17:14)
Dezember 06, Januar 07
Im Januar hatte ich einen Burberryschal gefunden an einem Dienstag in der Nacht nach dem Reden mit L, S, V, S nach den drei Filmen im Arthousekino. Zwei Tage danach oder einen Tag danach wusch ich den Schal mit Shampoo in meiner Spüle. Den schwarzen Schal hatte ich gleich mitgewaschen,... by mbaute (07.02.07, 13:09)
All In The Present Must Be Transformed – Wieso eigentlich?
In der Kunst / Kino-Entwicklung, von der hier kürzlich im Zusammenhang mit dem neuen Weerasethakul-Film die Rede war, ist die New Yorker Gladstone Gallery ein Global Player. Sie vertritt neben einer Reihe von Bildenden Künstlern, darunter Rosemarie Trockel, Thomas Hirschhorn, Gregor Schneider, Kai Althoff, auch die Kino-Künstler Bruce Conner, Sharon... by pburg (17.12.06, 10:44)
Straub / Huillet / Pavese (II)
Allegro moderato Text im Presseheft des französischen Verleihs Pierre Grise Distribution – Warum ? Weil : Der Mythos ist nicht etwas Willkürliches, sondern eine Pflanzstätte der Symbole, ihm ist ein eigener Kern an Bedeutungen vorbehalten, der durch nichts anderes wiedergegeben werden könnte. Wenn wir einen Eigennamen, eine Geste, ein mythisches Wunder wiederholen,... by pburg (10.11.06, 14:16)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||