|
... Vorige Seite
Donnerstag, 3. März 2005
Marivaux, mon frère, Inch'Allah! "L'Esquive" heißt das Ausweichmanöver beim Boxen. Abdellatif Kechiches gleichnamiger Film, der gerade überraschend vier Césars gewonnen hat, kommt fast ohne Schläge aus, wenn er Vorstadt-Jugendliche beim Einstudieren eines Theaterstücks in der Schule zeigt. Über die Leistungsfähigkeit von Sprache und darüber, was sich mit Marivaux in der Pariser Banlieue anfangen lässt, sprechen Stefanie Schlüter, Ekkehard Knörer, Volker Pantenburg, Stefan Pethke und Simon Rothöhler. Stefan Pethke: Kechiche kommt mir vor wie jemand, der sehr genau hingeguckt hat, wie die Dardenne-Brüder seit 'Rosetta' arbeiten: er kadriert total eng und gibt damit auch einen reduzierten Blick auf die Welt wieder. Aber er macht die Welt dadurch nicht ärmer. So eine Mischung aus Konzentration und Detailgenauigkeit, die einen dafür entschädigt, dass man eigentlich die ganze Zeit ausbrechen und den Rahmen erweitern möchte. Das ist eine tolle visuelle Übersetzung des Schlüsselbegriffs in diesem Film: "Druck". Wenn ich als Zuschauer denke, ich möchte diesen Rahmen aufdrücken, dann komme ich genau hin zu diesem Begriff von "Pression". Volker Pantenburg: Jemand, der einen Film über Jugendliche in der Vorstadt macht, ist ja selbst einem Druck ausgesetzt: Spätestens seit den Achtzigern gibt es Banlieue-Filme, und seit Kassowitz' "Hass" ist das als Genre im Mainstream kanonisiert. In diesem Genre gilt es fast als Gesetz, die Energie der sozialen Brennpunkte von vornherein als problematisch, als potentiell gewalttätig zu schildern. Stefanie Schlüter: "L'Esquive" ist vor diesem Hintergrund eine Rückeroberung dieses Raums und ein politischer Akt: Der Film zeigt diesen Raum und rehabilitiert ihn nicht mit der naiven Behauptung, das Problematische sei nicht da, sondern zeigt in einer Bewegung der Abweichung, wozu diese Energie auch fähig sein kann. Pantenburg: Die erste Szene bleibt noch ganz im Rahmen der Gattung: Ein paar Jungs stehen aufgebracht zusammen und beschließen: "Den Typen machen wir fertig". Krimo, einer von ihnen, geht dann nach Hause, um seinen Tschako zu holen. Und dann, als Lydia reinkommt in die Geschichte, die ihr Rokoko-Kleid fürs Theaterstück beim Schneider abholt, findet die erste dramaturgische Abweichung statt. Pethke: Erzählt wird doch im Grunde, dass Krimo sich in dem Moment in Lydia verliebt, in dem er sie in diesem neuen Kleid sieht. Das ist gefilmt wie ein erster Blick, wie Liebe auf den ersten Blick. Erst hinterher erfährt man, dass die sich schon seit dem Sandkasten kennen. Pantenburg: Die haben die Liebe gewissermaßen nur aufgeschoben; darum geht es doch auch in dem Stück, das die Jugendlichen im Französischunterricht einstudieren. Ekkehard Knörer: Wobei das bei Marivaux sehr viel spielerischer ist, weil es ja darum geht, die Lust nicht aufzuschieben, sondern sie zu verlängern. Es gibt immer mehr Mitwisser, die halten aber immer mehr dicht und müssen immer forcierter dichthalten, um die Spielfläche weiterhin freizuhalten für die Verwechslungskomödie. Und die Stelle, an der hier im Film der größte Druck herrscht und zugleich der Rahmen bricht, ist die Szene, als die fünf von der Polizei aufgegriffen und brutal gefilzt werden. Pethke: Dramaturgisch ist da Schluss, danach sieht man nur noch die Theateraufführung, wie ein Nachhall oder ein Echo. Pantenburg: Der Polizeieinsatz war ein Schock. Da kommt auf einmal eine bösartige Form von Energie rein, die vorher zwar immer latent da ist, aber sich andere Wege sucht und findet. Der Schock besteht auch darin, dass das Figurenarsenal aufgesprengt wird. Plötzlich sind da Fremde, die da definitiv nichts zu suchen haben. Bei allen anderen Figuren hatte ich trotz allen Unwohlseins, das die mit sich rumschleppen, das Gefühl, dass die sich mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit und Sicherheit durch ihr Terrain zwischen den Häuserblocks bewegen. Die haben ihre Orte, ihre Konventionen, ihre Zeichensysteme und wissen, in welchen Konstellationen wer wofür zuständig ist. Das ist ja ein autarkes soziales System, das da abgebildet wird: Als Lydia Geld braucht, fragt sie Krimo. Um an die Rolle im Theaterstück ranzukommen, greift Krimo auf die eigenen geklauten Dinge zurück. Und dieser Rahmen, der eigentlich immer eingehalten wird, bricht in der Polizei-Szene. Knörer: Das ist zudem der einzige Moment, wo das Revier verlassen wird. Man weiß zwar nicht genau, wo die sind, aber man hat stark das Gefühl, dass es ein Außerhalb ist. Sie müssen da erst hinfahren – das ist ein bisschen wie beim klassischen Duell; die gehen vor die Stadt. Pethke: Ich glaube nicht, dass das eine Bewegung aus diesem Territorium heraus ist, sondern eine bestimmte Zone im Bezirk: Dieses Duell kann man auch in seinen eigenen Gefilden stattfinden lassen. Knörer: Sozusagen eine interne Exterritorialität... Pethke: Genau. Und dass genau da der Staat auftaucht, weil er eben weiß, dass da bestimmte Dinge laufen, die woanders nicht laufen, finde ich sehr logisch. Simon Rothöhler: Man hat nicht das Gefühl, dass dieser Ort ein Übergang ist zu besseren Vorstädten, es ist nicht so, dass die Polizei hier einen Brückenkopf markiert... Pethke: ... oder eine Grenze verteidigt. Auf keinen Fall. Rothöhler: Die Polizei hat einen selektiven Zugriff auf das Territorium und geht ziemlich willkürlich vor, zumindest nur stichprobenartig. Pethke: Es ist auch eine gefährliche Zone, da setzt man sich eben auch einem Risiko aus. Rothöhler: Außer diesem Ort gibt ja noch die Schule, die auch nicht zum Revier gehört, und die Lehrerin ist irgendwie auch eine Polizistin. Das ist halt eine permissive Brutalität, die sie ausübt. Man sieht genau: Die hat in Paris studiert und die feinen Unterschiede begriffen, ist jetzt aber nicht in der Lage, das pädagogisch zu realisieren. Und im Grunde genommen ist doch das Angebot mit dem Theaterstück ähnlich absurd wie die Polizeiaktion. Pantenburg: Aber die Lehrerin ist doch viel weniger bösartig. Ist sie nicht, wenn man bei der Druckmetapher bleibt, diejenige, die umlenkt, während die Polizisten ganz klar den Deckel draufhalten? Sie ist – ganz bewusst – mit Sublimation beschäftigt und die Bullen mit Verdrängung. Schlüter: Ich finde aber die Lehrerinnenrolle nicht so eindeutig. In der ersten Szene fand ich sie sehr restriktiv. Ich habe da nur den Mund wahrgenommen und die Zähne: Eine Person, die diktiert. Aber durch den Erfolg, den die Klasse am Ende mit dem Theaterstück erzielt, was auch eine Stabilität in der Gemeinschaft wiederherstellt, wird sie gewissermaßen rehabilitiert. Rothöhler: So stark will ich das auch gar nicht machen. Nur: Wenn man zwei Weisen unterscheidet, in denen der Staat in diese Gegend kommt, dann ist die Lehrerin nicht nur der gute Staat, der sich bemüht mit seinem hochkulturellen Impact und die Polizisten sind eben die Polizisten, sondern auch die Lehrerin hat so einen Polizeiaspekt. Pethke: Ich bin da nicht einverstanden. Wenn die Schule gleichgesetzt wäre mit Polizei als eine Staatsinstitution, dann würde das sehr viel stärker über eine direkte Machtausübung gehen, wie wir sie bei der Polizei ja auch sehen. Dann würden Noten ins Spiel kommen, dann würde es um Regeln gehen, die in diesem System herrschen. Deshalb ist die Schulklasse für mich eigentlich ein anderer Ort, nämlich der Ort der kanonisierten Kultur. Was macht man mit der? Lebt die noch? Wenn ja: wie? Darum muss es natürlich auch gehen, wenn man sagt: Jetzt kommt die Hochkultur in die Banlieue. Für mich repräsentiert die Lehrerin eher den Kulturschaffenden, sie hat die Interpretationshoheit. Es geht zwar, um Machtprozesse und Machtkonstellationen, aber um solche bei der Herstellung von Kultur. Knörer: Man kann zugleich ja nicht übersehen, dass sie die Stellvertreterfigur des Regisseurs ist, der in die Banlieue geht und das nochmal vorführt. Seine Rolle ist strukturell dieselbe. Schlüter: Ich finde, man kann diese zwei Seiten gut sehen, als Krimo das erste Mal vor der Klasse sprechen soll und sie ihn bis zum Äußersten triezt. Man könnte das als eine repressive Situation verstehen, aus der er ausbrechen muss – auch weil er diese Doppelrolle hat als Liebender und als Schauspieler. Aber auf der anderen Seite kann man das auch als Geste eines Regisseurs lesen, der seine Schauspieler mit harten Bandagen zum Agieren bringt. Rothöhler: Ja, damit wird ein Beobachterstandpunkt innerhalb des Films markiert. Er markiert seinen Eingriff über diese Erzählung der Lehrerin. Sonst ist man ja bei so einem Modell von Verismus... Pantenburg: ... von "Unmittelbarkeit", Rothöhler: So, als könne man in den Räumen drin sein, die Kechiche natürlich niemals von innen sehen kann, wenn er mit seiner Kamera da hin kommt und das auf bestimmte Thesen hin präpariert. Das öffnet er damit ja wieder. Das würde Larry Clark nie machen. Knörer: Aus ideologischer Verblendung. Pethke: Stimmt. Larry Clark taucht in seinen Filmen nicht wirklich auf, der entzieht sich als "Buddy". Schlüter: Wozu der Film keine eindeutige Position bezieht, ist die Frage von Einschluss- und Ausschlussmechanismen in der Aneignung von Sprache. An Krimo wird das exemplifiziert. Über das Theaterstück sagt er einmal: "Die Sätze sind zu lang. Ich krieg die nicht in meinen Kopf." Er zeigt das durch sein Verstummen und durch seine Körperhaltung. Er läuft ja die ganze Zeit mit hängenden Schultern und einem etwas ausdruckslosen Gesicht durch die Gegend. Und solche Grenzlinien zwischen Einschluss und Ausschluss gibt es auch zwischen den Freunden. "Ah, der spielt jetzt Theater, dann gehört er nicht mehr zu uns."
 Pantenburg: Die Lehrerin formuliert einmal provokativ eine Art Moral des Marivaux-Stücks: "Man kann seine Herkunft nicht abschütteln, so sehr man sich auch anstrengt". Könnte man das nicht als Moral des Films missverstehen? Pethke: Auf keinen Fall. Denn wenn es um eine Übertragung Marivauxscher Verhältnisse gegangen wäre, dann hätte ja einer aus dem reichen 16. Arrondissement da einbrechen müssen. Rothöhler: Oder Krimo hätte sich in eine Bürgertochter verlieben müssen, die zum Cello-Unterricht muss. Pethke: Genau, die reiche Welt ist wirklich komplett ausgespart. Pantenburg: Ziemlich früh gibt es die erste Marivaux Probenszene im diesem angedeuteten Amphitheater. Da sieht man Lydia in ihren Kleid und die Trabantenstadt-Silhouette. Darin liegt auch eine Erweiterung des Publikums. Die Fenster der Wohnblocks blicken alle auf dieses Theater.
 Rothöhler: Ist das nicht die erste Szene, in der sich der Raum öffnet? Man geht doch in den Film rein mit Großaufnahmen – wirklich wie bei "Rosetta", zwar nicht auf den Rücken der Figuren gefilmt, sondern auf die Gesichter, sehr schnelle Schnitte, aber auch keine Reißschwenks, sondern in so einem Stakkato. Knörer: Aber den ersten explizit gesetzten Theaterauftritt gibt es schon vorher. Vor dem Fenster der Freundinnen, wo Lydia den Raum sofort zur Bühne macht, wenn sie sich zuerst hinter der Mauer versteckt und dann aus diesem Off heraus ihr neues Kleid präsentiert. Die Frage ist aber, ob das eine Struktur ist, in der etwas ausdrücklich ausgestellt wird, oder ob es nicht eher eine klassische Spiel-im-Spiel Struktur ist, die den Illusionsraum geschlossen hält. Das wäre ja ein wichtiger Unterschied. Rothöhler: Ist das eine Geschichte der Aneignung von Kultur? Sehen wir zu, wie sich die Kids über diese fremde Sprache Freiräume schaffen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Film nicht doch auf dieser Differenz beharrt. Pethke: Absolut. Rothöhler: Und das empfinde ich als Stärke. Es ist ja nicht so, dass die mit diesem Text konfrontiert werden und dann über Liebe sprechen können. Das bleibt denen total äußerlich. Pantenburg: Ich glaube auch, dass der Theater-Text hier eher Material ist, das auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen benutzt werden kann. Eben nicht zwingend über Aneignung, In-die-Rolle-Schlüpfen und Sich-selbst-Finden. Bei Krimo zum Beispiel ist das ja ganz pragmatisch gedacht. Der Text ist die Leiter, mit der ich ans Fenster meiner Liebsten hochklettere, so unbeholfen ich das auch hinkriege... Rothöhler: ... Das Gegenteil von method acting. Pantenburg: Utilitarismus. Und das wird nicht abgetan als eine illegitime Verwendungsweise des klassischen Textes, sondern als eine ganz tolle Art gezeigt, wie man mit diesem Text umgehen kann. Pethke: Man könnte doch auch umgekehrt sagen: Die Aneignung, die hier stattfindet, ist die eines mit dem kulturellen Kanon bestens vertrauten Regisseurs, der sich der Schönheit der Banlieue-Sprache zuwendet. Es gelingt ihm zu zeigen, dass er da Schönheiten entdeckt und die organisiert. Er nimmt also die Sprechweisen von denen überhaupt wahr und auch ernst. Rothöhler: Marivaux ist kein Medium für die, zu Ausdrucksformen zu finden, sondern bietet eher eine Chance, über die Distanz zu diesem Text zu sprechen. So baut der Film das. Der Text bleibt ja immer fremd. Egal, ob er leidenschaftlich deklamiert wird von der Lydia oder ob er wirklich nur widerständiges Sprachmaterial ist wie bei Krimo.
 Knörer: Was die Sprach-Szenen in den Auseinandersetzungen untereinander ganz stark strukturiert, sind Sitzordnungen und polyphones Zusammenspiel, sobald es mehr als zwei sind, die da reden. Wie zum Beispiel laut/leise-Wechsel inszeniert werden. Das ist ja fast schon mehr als die Bühne leisten kann. Pantenburg: Und im Gegensatz zu Marivaux lässt sich das auch nicht verschriftlichen. Das ist nur über Improvisation zu erzeugen, also über ein Modell von Mündlichkeit. Weil die Dardenne-Brüder eben genannt wurden, bei denen Arbeit so ein zentraler Begriff ist; ich glaube, dass es auch hier um Arbeit geht. Arbeit an der Sprache, Arbeit mit Schauspielern. Rothöhler: Es gibt ja bei den Dardennes einen positiven Arbeitsbegriff. "Le Fils" endet quasi mit einer Kollektivierung, bei der man nicht gemeinsam spricht – das wäre das Modell hier – sondern gemeinsam ein Stück Holz bearbeitet. So wird dort die Schuldfrage gelöst: Man ist erschöpft, man hat sich durch einen Raum gejagt, die Körper sind müde, jetzt kann man gemeinsam arbeiten. Das ist ein utopischer Arbeitsbegriff. So ist das hier auch mit der Sprache. Man kann weiter sprechen. Aber das wird natürlich immer auch räumlich inszeniert. Das ist kein reines Dialogkino, auch nicht in der für mich zentralen Verführungssequenz in der, als Krimo Lydia aus dieser Gruppe von Mädchen herauslöst und sie erst nicht kommen will. Sie sitzt da in der Mitte wie eine Prinzessin. Und aus diesem Tableau muss er sie erst herauslösen, was wieder wie ein Theater-Auftritt gefilmt ist: Er steht am Baum, raucht die Zigarette noch auf, man sieht nur ihn, dann ein Schwenk, dann die Gruppe, und er geht auf die Gruppe zu. Pethke: Du kannst diesen Film wirklich nur mit diesen Leuten machen. Die Vorstellung, den Text einen Schauspieler wieder aufführen zu lassen, die ist gruselig. Schlüter: ... ungefähr so gruselig wie die, was den Slang angeht, oft ahnungslosen deutschen Untertitel. Rothöhler: Ist es nicht so, dass bei solchen Laienfilmen die Laien häufig über ihre Körperlichkeit angezapft werden und nicht über ihre Sprache? Man fordert sie dann auf, nicht so viel zu sprechen, sondern eher auf eine bestimmte Art und Weise die Straße entlangzulaufen, und hier wird das ja voll auf die Sprache gemünzt. Und das finde ich irgendwie erstaunlich, wie er die in diese Temperatur versetzt, diese Sprache so abzurufen: Es ist ja nie ein falscher Ton dabei, selbst wenn sie ihren Amateur-Status bei den Marivaux-Proben bewusst nochmal konstruieren müssen – Laien, die Laien spielen. Selbst das ist genuin, wie Lydia als Schauspielerin agiert. Knörer: Bei Thomas Arslans Filmen zum Beispiel ist das ja völlig anders. Da werden die Laien distanzierend eingesetzt. Das Interessante an "L'Esquive" ist, dass das Spiel der Laien so weit getrieben wird, dass es schon wieder als Geschauspiele authentifiziert ist – und das ist ja schon extrem schwierig, eine wirklich hohe Kunst. Pantenburg: Kechiche lässt die in einer solchen Intensität nicht schauspielern, dass quasi die Unterscheidung kollabiert... Schlüter: Man hat den Eindruck, dass die Jugendlichen ihren Raum recht gut beherrschen. Das lässt sich auch an der Kommunikation über die Klingelanlagen und über die Fenster beschreiben, die so abläuft, als wären die Jugendlichen allein in diesem Raum. Pantenburg: Das ist noch mal so ein ironischer Wink. In Frankreich wird diese Handyverschuldung unter Jugendlichen ähnlich hoch sein wie hier. Und die Kids sind sich völlig klar darüber: "Tut mir leid, kein Guthaben", und deshalb ruft man halt ganz archaisch oder benutzt die Gegensprechanlagen. Es gibt präzise Taktiken, damit umzugehen. Rothöhler: Wobei das natürlich welche sind, die den Raum noch einmal abdichten. Wenn du die Gegensprechanlage nutzen musst, kannst du nicht auf die Champs-Elysées fahren und sagen, dass du dort bist. Pantenburg: Interessanterweise braucht "L'Esquive" den Kontrast zur Großstadt gar nicht. Der Film braucht nicht die Stadt als Verlockung, nicht als Sehnsucht, als Ort, an dem man konsumiert, um die Vorstadt zu erzählen. Knörer: Was der Film bei der Theateraufführung in der Schlusssequenz betont, ist, dass alle im Publikum, Eltern, Mitschüler auf das Stück reagieren, und zwar angemessen reagieren. Das kann man sich ja auch anders vorstellen. Es ist keine Frage, dass das ein liberaler Film ist. Das sieht man da ganz deutlich. Rothöhler: Wir haben aber schon so ein bisschen die Message: Alles OK in den Banlieues. Pethke: Nee, finde ich nicht. Der Film hat überhaupt kein propagandistisches Interesse. Dazu bleibt er dann auch zu sehr auf des Messers Schneide. Pantenburg: Ich fände es nicht überraschend, wenn da doch einer abgestochen würde. Das ist ja kein Raum, in dem das jetzt eliminiert oder suspendiert wäre. Pethke: Nee, das ist genauso rausgekascht wie vieles andere. Rothöhler: Ich dachte das nur, weil dieser eine Gefahrmoment mit dem Polizeieinsatz so stark betont wird. Und wenn man das dann abzieht, dann ist es ja schon so, dass intern alles gut funktioniert. Pethke: Die Gewalt findet in der Sprache statt. In der Art, wie die Sprache klingt, wie sie eingesetzt wird, welchen Druck sie selber hat und erzeugt. Rothöhler: Ich fand aber, dass diese Sprache trotz ihrer roughness, trotz dieser gewalttätigen Begriffe, die da im Raum stehen, nicht wirklich auf Referenz aus ist. Die Sprache wird von ihrer Leistungsseite her gezeigt. Wenn die sich beleidigen geht es nicht darum zu sagen, dass jemand eine Nutte ist, sondern um die interne Logik dieser Sprache. Im Prinzip ist es ziemlich diskursiv, was die da machen. Pethke: Ist das nicht der Unterschied zwischen Waffenbesitz und Waffengebrauch? Ständig wird verbal gefuchtelt mit allem, und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn das Ding irgendwann mal hochgeht. Die wissen schon, was alles passieren kann, aber das entbindet sie nicht von der Pflicht, ständig in dieser Aushandlungspraxis zu bleiben. Knörer: Aber das gilt doch auch umgekehrt, oder? Wenn mit Waffen ständig rumgefuchtelt wird, glaubt man irgendwann nicht mehr, dass sie auch losgehen können. Schlüter: Vielleicht ist die Sprache vor allem ein Mittel der Übertreibung. "Playing the Dozens". Immer noch einen obendrauf setzen. Sich sprachlich so hoch schaukeln, bis es nicht mehr geht. Pantenburg: Schon in der ersten Auseinandersetzung darüber, ob Krimo bei der Probe zusehen darf oder nicht, ist es erstaunlich, was für ein Wissen um die Gesprächsverschiebungen sichtbar wird. Wie schnell das hin- und hergeht. Schuldzuweisungen, Schuldverschiebungen, blitzschnelle Argumentation. Pethke: Das ist toll, wie Lydia, die Lucky Luke-mäßig schneller spricht als ihr Schatten, das hinbekommt. Das ist ja eigentlich ein absolutes Ausschlusskriterium für die Schauspielerei: Tempo vor Artikulation. Aber hier steht eben das Sprechen als performativer Akt im Vordergrund. Kechiche macht aus Sprache Kino. Schlüter: Lydia versucht diese Druck-Situation ja zu unterlaufen. Sie sagt: Ich kann mich unter Druck nicht entscheiden, und deshalb schiebt sie die Antwort auf. In dieser Szene im Auto, als sie sich jetzt gefälligst mal für oder gegen Krimo entscheiden soll, ist der Druck ja ganz spürbar. Das ist der engste Raum des ganzen Films, und die anderen drei stehen als Überwachungsinstanz frontal davor. Pethke: Oder als Publikum. Pantenburg: Und die Bullen kommen von hinten. Rothöhler: Über den einzigen druckfreien Raum haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist die Wohnung von Krimo und seiner Mutter. Sie spricht beim Bügeln mit ihm und man würde erwarten, dass sie stärker darauf insistiert, dass er mitkommt, um den Vater im Gefängnis zu besuchen. Das tut sie nicht. Da ist Krimo ja am zugänglichsten und antwortet auch in einem ganz anderen Tonfall als sonst, flirtet ein bisschen mit seiner Mutter. Er hat eine ganz andere Temperatur in dem Moment. Das ist vielleicht sein Gegenraum zu den anderen. Schlüter: Aber da hat es keinen Platz für Lydia. Rothöhler: Lydia schafft es eben nicht, Krimo in einen anderen Sprachmodus zu übersetzen. Sie üben ja zusammen das Theaterstück und sie versucht, das Modell der Lehrerin zu übernehmen und ihm in den Text zu helfen, aber sie unterbreitet ihm kein Kommunikationsangebot, auf das er eingehen kann. Er kann auch nur sehr hart seinen Wunsch artikulieren, mit ihr zusammen zu sein. Er kann diesen mütterlichen Raum, wenn man so will, nicht herstellen, auch nicht über diese Marivaux-Schleife. Pethke: Interessant ist ja, dass Frida, die ohnehin immer die ist, die am meisten abkriegt, obwohl sie dafür gar nichts kann, auch in der Polizeiszene der Trigger ist für die Eskalation. Frida und Marivaux: Sie will das Buch verbergen oder hat vergessen, dass es noch in ihrer Tasche steckt; das wird ihr als Verheimlichen ausgelegt. Und die Bullen sind dann zu dämlich zu erkennen, dass davon keine Bedrohung ausgeht. Schlüter: Dann aber dieser harte Schnitt auf die Theaterszene, diese Gelenkstelle zwischen Polizeieinsatz und Theateraufführung. Es geht zurück in die Kulturszene, obwohl der Marivaux eben vorher nichts ausrichten konnte. Rothöhler: Das ist ja unter anderem ein Cliffhanger. Man fragt sich die ganze Zeit: Was für Folgen hat dieser Polizeieinsatz gehabt? Knörer: Und es ist spannend: Wo ist Krimo? Wird der auf der Bühne erscheinen?
L'Esquive, F 2004, Regie: Abdellatif Kechiche, mit Osman Elkharraz (Krimo), Sara Forestier (Lydia), Sabrina Ouazani (Frida), Nanou Benahmou (Nanou), Hafet Ben-Ahmed (Fahti), Aurélie Ganito (Magalie) u.a. [Eine kürzere Fassung des Gesprächs erscheint in der Jungle World 10/2005] pburg, 3. März 2005 um 18:07:30 MEZ ... Link Freitag, 29. Oktober 2004
Viennale 04 (Teil 2)
Wien, Samstag bis Montag 23. bis 25.10.04 Lisandro Alonso: LOS MUERTOS (Argentinien 2004) Während Michael sich schon wieder auf der Heimreise befunden hat – und in Prag die entbehrten CoF gleich stangenweise in die Arme schließen konnte – gab es in Wien noch einige "schöne Projektionen", wie man dort zu kalauern pflegt. Zu sehen war, das sei nachgereicht, ein weiteres Dschungelstück. Lisandro Alonsos zweiter Spielfilm LOS MUERTOS erscheint mir in dem Maße materialistisch, wie die zweite Hälfte von SUD PRALAT allegorisch ist: nämlich objektiv, um eine Unterscheidung aufzugreifen, die Bert in der aktuellen Kolik (Sonderheft 2/2004) neu produktiv macht. Das Kino der Objektivität gehört demnach jenen Filmemachern "die sich an Instanzen abarbeiten, die sie sich nicht selbst auferlegt haben" (S.52); es ist nicht per se mit naturalistischen Ästhetiken oder wirklichkeitsnahen Sujets identisch und kann insofern grundsätzlich auch mythologische und hyperbolische Verfahren zum Einsatz bringen. Mir fällt spontan kein jüngerer Film ein, der die Vorstellung einer allegorischen Wahrnehmung so konsequent objektiviert, wie SUD PRALAT. Alonso gehört zwar auch zu den Objektiven, aber eher zum geerdeten Pol. Das zeigt sich vor allem daran, wie er die beiden komplementären Lebensräume seiner Hauptfigur Argentino Vargas – Gefängnis und Urwald – über die Beobachtung konkreter Alltagspraktiken, die primär der Befriedigung von Grundbedürfnissen dienen, aufschließt, ohne dabei so eine unangenehme survivalistische Feierlichkeit legitimieren zu wollen, die sich dann ja vermutlich auch formal anders artikulieren würde. Die Objektiven bevorzugen in der Regel ohnehin induktive Herangehensweisen: "Die Einstellungen verdanken sich dort nicht einem Genießen, auch nicht einem Wissen, das dem Bild vorausliegt – die Bewegung des Films ist vielmehr genau mit der Erschließung des Wissens identisch" (ibid.). In SUD PRALAT ist dieses Wissen ein allegorisches (ein Tiger leuchtet), in LOS MUERTOS eine Frage des Überlebens (eine Ziege wird geschlachtet). Arnaud Desplechin: LEO – EN JOUANT « DANS LA COMPAGNIE DES HOMMES» (Frankreich 2003) Das bedeutet andererseits aber nicht, dass ausagiertes Stilbewusstsein und offene Selbstreflexivität unbedingt subjektives Kino, falsches Genießen und defiziente Welterschließung anzeigen müssen. Diesen Eindruck hatte ich zumindest bei Arnaud Desplechins LEO – EN JOUANT "DANS LA COMPAGNIE DES HOMMES", der (mindestens) drei Ebenen ohne Manier beständig ineinander schiebt: die erzählte Geschichte, die Dreh-Proben auf einem DOGVILLE-artigen Minimal-Set und Kommentare der Schauspieler zu Edward Bonds herrschaftskritischem Theaterstück, auf das der Film referiert. Dabei geschieht es mitunter, dass ein Gegenschuss aus der Proben-Ebene kommt, obwohl die Szene ansonsten in der ‚ersten’ Diegese spielt. Es geht Desplechin aber weniger um V-Effekt und Bewussthalten jener Prozesse, über die Figuren erarbeitet werden, sondern vor allem um die Macht- und Rollenspiele der erzählten Figuren. Diese sind einerseits verstrickt in undurchschaubare Waffenexport- und Übernahmegeschäfte, andererseits aber auch neurotisch fixiert auf familiäre Beziehungsmuster, die sich danach sehnen, genuin ödipal und tragisch zu sein. Die "new princes of global capitalism" (Desplechin nach dem Film) tragen ihre Charaktermasken aber nicht nur als Arbeitskleidung – gerade wenn sie sich abseits der professionellen Räume der Hochfinanz bewegen und ein immer diffuser werdendes ‚Privates’ suchen, fehlt ihnen jene Rollenbegabung, die Fallhöhe im klassischen Sinn erst stiftet. John Ford: THE WINGS OF EAGLES (USA 1957) Zu lernen war weiterhin, dass Genre-Hybride keine Erfindung der ‚Postklassik’ sind (ein Begriff, der ohnehin nie wirklich trennscharf operiert). John Fords THE WINGS OF EAGLES beginnt als turbulente Militärklamotte (John Wayne chargiert zeitweilig wie ein wegen zu exzessiver Albernheit verstoßenes Stooges-Mitglied), wechselt zweimal so unvermittelt wie beherzt ins Melo, täuscht kurz Screwball an, vereitelt die Remarriage dann aber schließlich via Kriegsfilmwerdung, wenn dem nur fast gezähmten Paar die Weltgeschichte – Pearl Harbor statt zweiter Honeymoon – in die Quere kommt. Zusammengehalten wird dieser großartige Irrsinn wie so oft vor allem durch den Körper von John Wayne, der zwischenzeitlich in einen Rollstuhl verbannt wird, nur um am Ende eine durch Autosuggestion bewirkte Genesung zu erleben, die mit der Auferstehung des US-Militärapparates nach der Pearl-Harbor-Paralyse ziemlich deutlich parallelisiert wird, was dann ja auch wieder eine objektive Qualität wäre. Simon Rothöhler filmkritik, 29. Oktober 2004 um 15:11:08 MESZ ... Link Donnerstag, 28. Oktober 2004
Viennale'04 (Teil 1) Wien, Montag bis Samstag, 18. bis 23.10.04 Am Montagnachmittag aus dem Fenster des EC in Tschechien Leute zu Fuß auf der Landstraße ihren Weg gehen gesehen; währenddessen ununterbrochenes tschechisches Rauchen in dafür vorgesehenen Raucherabteilen. Schließlich Wien Südbahnhof. Kopfbahnhof. Stadt der Ringe und Gürtel, wärmer als Berlin und beleuchteter. Menzelgasse, mein Lager in Wien
Filmmuseum Urania Stadtkino Metro Gartenbaukino Apichatpong Weerasethakul: SUD PRALAT (Tropical Malady) (Thailand/F/D/I 2004) SUD PRALAT ist der tollste Film, den ich während der Viennale gesehen habe in den 5 Tagen. SUD PRALAT leuchtet mysteriös. Knörer hat, das sehe ich am Computer der Viennale-Pressestelle, auf Interviews mit Apichatpong Weerasethakul verlinkt. Die muss ich noch lesen. Es gibt am Anfang eine Geschichte von Soldaten im Dschungel. Sie gehen in Gräsern entlang eines Waldes, es scheint kein Kampf zu sein, aus dem sie kommen oder in den sie ziehen. Es ist eher ein Ausflug, der entspannte Teil eines Manöver oder Teil eines unaufgeregten Dienst. Die Soldaten machen Erinnerungsfotos mit Digitalkameras von sich und einem menschlichen Körper. Deutlich auf der Tonspur hört man die sirrenden Geräusche der digitalen Apparate. Den Körper erkennt man erst nach einer Zeit, die Kamera ist ein paar Meter von der Gruppe entfernt und die Gräser wachsen hoch und die Kamera erhebt sich nicht über die Gräser. Dass der Körper tot ist, erkennt man noch später, die Soldaten tragen die Leiche zu einem Haus auf dem Land. Die Szene ist fragmentarisch aufgebaut, durch Schnitte unterteilt, die das vorhergehende Positionsfinden der Kamera betonen, als dauere die Handlung länger als deren Abbildung. Keines der Bilder wirkt klassisch komponiert, weil die de-linearisierenden Jump-Cuts die unterschiedlichen Blickwinkel und Einstellungsgrößen hervorheben. Die Bilder sind nicht in einer klassischen Grammatik aneinander gelegt, Bewegungen gehen von einem Bild zum anderen ins Leere, nachfolgende und vorhergehende Kadrierungen verzahnen sich nicht zu einem laufenden Fluss mit eindeutiger Bewegungsrichtung. An dem Haus angekommen, verbringen die Soldaten dort die Nacht, Geschichten werden erzählt und einmal gibt es ein Bild von der Leiche, die nun nur noch als Schema und Kontur von der einsetzenden Dunkelheit zu unterscheiden ist. Später scheint der Film die Leiche vollkommen zu vergessen. Der Film scheint sich nicht an sie und die Soldaten zu erinnern. Es folgt nun die erste Hälfte des Films, eine fragmentarische Geschichte vom Leben in einer Stadt, irgendwann später. Diese erste Hälfte des Film, nach dem Prolog mit den Soldaten, ist größtententeils städtisch und hell. Die zweite Hälfte des Film ist größtenteils dunkel. Die zweite Hälfte des Films handelt im Dschungel. In hohem Gras, in tiefen Wäldern. In einer Nacht. Die Farben der zweiten Hälfte des Films wirken zunächst monochrom, nach einer Zeit erkennt man mehr als ineinander übergehende Schemen in ihnen. Es gibt ein sehr dunkles, fast schwarzes Nachtblau; ein sehr tiefes, sattes, blauschwarzes Grün; und es gibt ein mehrfach abgestuftes Schwarz. Es gibt die Farbe menschlicher Haut. Von den Farben unterscheidet sich die Kontur des Mannes. Der Mann ist einer der beiden Männer, von denen der erste Teil des Film handelte. Der Mann verfolgt die Transformation eines Tigers in einen Menschen, vielleicht aber auch die eines Menschen in einen Tiger. Zwischentitel mit Emblemen, die über den Bildern der Nacht zu lesen sind, erzählen die Geschichte eines bösen Geistes, der die Gestalt eines Tigers, aber auch die eines Menschen annimmt. Der Mann, dessen städtisches Leben in der ersten Hälfte des Film gezeigt wurde, steht in einem Verhältnis, das nicht eindeutig ist, zu der in den Zwischentiteln erzählten Geschichte des Geistes. Vielleicht spielt auch der andere Mann, dessen Verhältnis zu dem ersten erzählt wird, in diesem Teil des Film eine Rolle, aber man sieht ihn nicht. Es ist alles sehr unklar. Aber es wäre undeutlich, diesen Teil der Geschichte mit dem Ausdruck mise en abyme zu bezeichnen. Es ist anders, physischer. Ein Tiger steht in der Nacht auf einem starken Ast eines Baumes. Der Tiger spricht in die Gedanken des Mannes, aber man sieht nicht wie der Tiger spricht. Tiger können auch in diesem Film nicht sprechen. Man sieht zunächst in einer Totale die Form eines Baumes und erkennt nach einer Weile, dass ein Tiger auf einem Ast des Baumes steht. Man sieht dann den Tiger frontal in einer bildfüllenden Großaufnahme zu der Kamera blicken. Es ist beim Sehen eine ungeheure Neuigkeit in den Bildern des Tigers, nie zuvor habe ich Formen und Farben eines Tigers wie in diesem Film gesehen. Das Ungeheure des ganzen Films rührt nicht von einem revoltierenden Schnitt und auch nicht von einer vollkommen neuen Art, Bilder zu machen oder auszustellen; und auch rührt das Ungeheure des Films nicht von der Geste, vollkommen neue Bilder machen zu wollen oder der Ausstellung dieser Geste, wie es westlich geprägten Avantgardebehauptungen zu eigen wäre. Es geht dem Film nicht um Setzungen solcher Art. Der erste Teil des Films nach dem Prolog ist in einer tatsächlichen und auch als Westeuropäer nachvollziehbaren städtischen Welt angesiedelt. Die Bilder des ersten Teils erzählen mit geraumer Distanz von üblichem Leben und einer latent homosexuell geprägten Annäherung zweier Männer. Der Schnitt betont das Episodische, Alltägliche, in der Realität verankerte dieser Bilder und Geschichte. Die Bilder und ihre Montage sind geprägt von einem ausgeglichenem Verhältnis zwischen dokumentierter Wirklichkeit und aus ihr geschälter fiktionaler Erfindung. Erst nach und nach schält sich das Interesse des Films an der Beziehung der beiden Männer heraus, erst nach und nach spürt man in den Bilder bisher Unangesprochenes. Das unausgesprochene Latente der Beziehung verlangt nach Erklärungen, zumindest nach einem neuen Focus, und wie auch immer man es anstellte: nun müßte Dramaturgie das Kommando übernehmen. An dieser Stelle setzt der zweite Teil des Films nach einer kurzen Konjunktion ein. Der zweite Teil des Films setzt an einer Stelle ein, an der die Beziehung der beiden Männer zu einer so spannenden und die Erzählung prägenden werden würde, dass die Weiterverfolgung des bisherigen elliptischen Erzählverfahren zwar möglich, aber wie eine erzähltechnische Veranstaltung von provokativer Vorenthaltung daherkommen würde. Die Konjunktion vom ersten zum zweiten Teil verhält sich wie der Prolog mit den Soldaten im Dschungel zum ersten Teil: sie scheint keine Beziehung zu besitzen zum Nachfolgenden. Was sie leistet: sie bildet einen vorläufigen und akzeptablen Schluß des ersten Teils, das Ende des Elliptischen. Sie bildet dem zweiten Teil eine Basis. Dieser zweite Teil des Films im Dschungel ist ganz ungeheuer. Man muss sich das anschauen. Er ist zu weiten Teilen im Schuß/Gegenschuß-Verfahren erzählt, die Einstellungsgrößen sind Totalen, Halbtotalen, Halbnahe und Nahe, ganz selten Close-Ups. Die Kamera wackelt nicht, selten wird geschwenkt und nie die Schärfe verlagert. Man sieht den Mann, wie er sich vorsichtig und so leise wie möglich im Dschungel bewegt und man sieht diesen Dschungel in der Nacht. Man müßte über die Töne dieses zweiten Teil des Films schreiben. Gegen Ende des zweiten Teil des Films gibt es ein Bild von einem alleinstehenden Baum am Rand des Dschungels. Die Äste des Baumes leuchten flimmernd. Das kommt von den Glühwürmchen in den Ästen des Baumes in der Nacht. Man kann, wenn man möchte, das Leuchten des Baumes auf den Film beziehen. (Dienstag, 19.10.2004, 21:00, Urania) Ross McElwee: BRIGHT LEAVES (USA 2003) Der Film ist da und gerechtfertigt durch die Behauptung, eine Recherche zu sein und das Bedürfnis zu befriedigen, ihm eine "transfusion of southerness" zu verpassen. Er muss deswegen zurück nach North Carolina. So Ross McElwee zu Beginn im Tabakfeld, ein Pflanzenblatt in der Hand haltend. Do not mistake that for a madeleine, das Tabakblatt ist mehr als nur der Impuls des Films. Ross McElwee bewegt sich physisch entlang einer Geschichte der Kultur des Tabak (und der der Medizin, die die körperlichen Folgen des Tabakkonsum behandelt) in die Südstaaten. Buch: Ross McElwee. Kamera: Ross McElwee. Ton: Ross McElwee. Schnitt: Ross McElwee. In SHERMAN'S MARCH, dem Film, der mit Ross McElwee als Protagonist und Autor die Wanderung des Südstaatengeneral als tragikomische Metapher von Südstaaten Exzentrik nachvollzog, sah man noch die bizarre Konstruktion, die McElwee sich dafür gebastelt hatte, der Filmemacher als One-Man-Band und Junggesellenmaschine. Hinzu kommt seither dieser verquere und Melancholie nur als Behauptung und Rutsche für Stimmungen stehen lassende Humor, der diese anachronistische Autarkiebehauptung gegen Einwände schützt: ganz sacht ist der und besorgt darum, nicht mißverstanden zu werden. Am zu erzählenden kapitalistischen Widerspruch ausgerichtet, dass der Tabak (die bright leaves, die den milden Geschmack der Zigaretten ergeben), der die Menschen abhängig macht und durch Krankheiten zerstört, zugleich solch eine reiche Kultur erzeugt hat. McElwees Methode: Sich permanent, nachdem ein Teil der Geschichte erzählt zu sein scheint, ins Wort zu fallen, um den Rest der Geschichte vom Stottern abzuhalten; jedes einfallende große Aber als kleines und dann zu erzählen. Die Verzweigungen der Situation "ich" als Erzählverfahren, ein andauerndes Weitermachen - Suchen, Finden, Abstoßen, Integrieren, und vor allen Dingen: Weitermachen. Mäandern, als sei es die natürlichste aller Ausdrucksformen, zu Bildern des Heranwachsens seines Sohn, Super-8 und Videoaufnahmen von vergangenen Familienfeiern, die Filmsammlung des Cousin, Gary Cooper als Tabakbaron in Michael Curtizs Bright Leaf (USA 1950), das spezielle Idiom einer Tabakauktion, die neoklassizistischen Anwesen der Tabakbarone, der McElwee Park, Duke University, eine bizarre Unterhaltung mit einem grotesken Filmtheoretiker, das Tabakmuseum, die automatische Zigarettenstopfmaschine, die Behandlung Krebskranker, ein Blick in die reflektierende Scheibe eines Schaufensters, das Grab des Urgroßvater, eine Familiengeschichte im Konjunktiv, "making special effects without having a special effects department", die verhinderte Rauchentwöhnung eines befreundeten Paars und ein Hund, der das Selbstporträt des Autors als Versonnenen verhindert, indem er bellend und beißend hineinprescht in das absichtsvoll leergehaltene Bild durch das McElwee, der die Kamera auf ein Stativ gestellt hatte, wandeln wollte. (Dienstag, 19.10.2004, 13:30, Urania) Tabak Austria. Keine Camel ohne in ganz Wien, keine Pall Mall, keine Luckies. Verboten! -Warum, seit wann? -Weiß nicht, seit zwei Jahren vielleicht. "kannst du mir eine stange camel ohne filter mitbringen? es gibt sie nicht zu kaufen in wien. dir ewig dankbar wäre ich, michael" McElwee sich vorzustellen als kinematographischen Kaminfeuer-Erzähler, den Onkel, den zu besuchen man sich freut, den verlassen zu können man aber eben so froh ist. Das Erdrückende dieser allumfassenden Freundlichkeit, mit der zu allem und jedem Belangvolles gesagt wird, die "alte Humanität". Wie er, als sei es noch natürlich, immer von sich auszugehen scheint, als vielfach bedingter Sprecher allerdings, geformt von einer mit jeder neuen Artikulation sich verfeinernden Wahrnehmung, die historischen mit Möglichkeitssinn koppelt. Dessen pathetisches Projekt: die Tradierung von Artikulation. Sich vorzustellen das Treffen Kluge/McElwee - deren spezieller Konservatismus (Leni Peickert als Geschichtslehrerin auf der Suche nach neuen Perspektiven auf das mangelhafte Ausgangsmaterial "Geschichte"). MANCHURIAN CANIDATE (USA 1962) von John Frankenheimer Wenn du denkst, es reicht dem Film nun dessen Zustopfen und Anstauen von Zeichen unausweichlicher Stasis, und dass er jetzt irgendwann für das Fließen der continuity sich entscheiden müsse, legt er noch einen layer of anxiety drängend hinzu. Zieht die Schrauben fester. Kaum eine Bewegung als Bewegungsbild zu sehen, alles ist in Tiefenschärfebildern und diese durchkreuzende Diagonalen inszeniert. Montage von Schwarz und Grau. Keine Öffnung, den Determinanten zu entkommen, seien es innere (Mütter, Frauen) oder äußere (Kommunisten). Pynchons Methode ("V" wird 1961 veröffentlicht) minus Humor. Das Delirierende der Konspiration, der amerikanischste aller Erzählzugänge. Das finale Hitchcockarrangement aus THE MAN WHO KNEW TOO MUCH: die öffentliche Veranstaltung und deren Score, die Übersetung der heruntertickenden Uhr in eine musikalische Partitur und ein ohnmächtig Einzelner, der um das Bevorstehende weiß. Bei Hitchcock war diese Parallelmontagendemonstration noch ganz der Suspense gewidmet, die Zeichen suchten den Widerhall in einer Grammatik der Musik. Frankenheimers Aufnahme dieses Verfahrens am Schluß von MANCHURIAN CANDIDATE: eine Wahlkampfveranstaltung, bei der der Killer den Präsidentschaftkandidaten erschießen soll, damit dessen Stellvertreter den Erschossenen in seinen Händen hält für ein wirkungsträchtiges Bild. Die Figuren dabei sind stärker an politisch-psychologische und mediale Ideologien gebunden als bei Hitchcock. Ein Dispositiv, das 10 Jahre später Pakulas THE PARALLAX VIEW wieder aufnimmt, es von von hot in cool übersetzend. Und de Palma danach in den 80ern und 90ern in fast allen seinen Filmen barock (SNAKE EYES). Bringen amerikanische Filme dieses Dispositiv alle 10 Jahre neu zur Aufführung, darf man gespannt sein auf Jonathan Demmes Neufassung von THE MANCHURIAN CANDIDATE, die im November in den deutschen Kinos läuft. Auf was die Betonung da gelegt wird? (Samstag, 23.10.2004, 13:00, Gartenbaukino) dass filme meist zur falschen zeit einem begegnen, was die unwahrscheinlichkeit gelungener mitteilung erhöht. potenziert sich dies auf filmfestivals? oder begünstigen die als ausnahmesituation, weit weg von unbezahlten rechnungen, pfandflaschen wegbringen und klo saubermachen, das gelingen der mitteilung? das demokratische von großem nebeneinander und gleichzeitigkeit eines festival gegenüberzustellen dem aufwändig-rituellen des normalen kinobesuch (einen film auswählen; sich verabreden; sich zurechtmachen; die nachtbusverbindungen auschecken; die stundenlange werbung; das popcorn-publikum; die angst vor dem nachfolgenden gespräch; die erwartungen antizipieren des begleiters, den man zum kinogehen überredete, und die eigenen mit dem gesehenen und dem anderen in ein verhältnis rücken; die rückkehr in die übliche welt). was ist gelungene mitteilung? (wird fortgesetzt) Michael Baute mbaute, 28. Oktober 2004 um 14:17:35 MESZ ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8863 Days
last updated: 10.04.14, 10:40  Youre not logged in ... Login

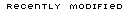 Danièle Huillet – Erinnerungen, Begegnungen
NICHT VERSÖHNT (1965) *** Jean-Marie Straub – Danièle und ich sind uns im November 1954 in Paris begegnet – wir erinnern uns gut daran, weil das der Beginn der algerischen Revolution war. Ich war mehrmals per Autostop nach Paris gekommen, um Filme zu sehen, die es bei uns nicht gab, LOS... by pburg (05.10.07, 11:58)
UMZUG
Nach knapp 2000 Tagen bei antville und blogger machen wir ab jetzt woanders weiter. Unter der neuen Adresse http://www.newfilmkritik.de sind alle Einträge seit November 2001 zu finden. Großer Dank an antville! Großer Dank an Erik Stein für die technische Unterstützung! by filmkritik (08.05.07, 15:10)
Warum ich keine „politischen“ Filme mache.
von Ulrich Köhler Ken Loachs „Family Life“ handelt nicht nur von einer schizophrenen jungen Frau, der Film selbst ist schizophren. Grandios inszeniert zerreißt es den Film zwischen dem naturalistischen Genie seines Regisseurs und dem Diktat eines politisch motivierten Drehbuchs. Viele Szenen sind an psychologischer Tiefe und Vielschichtigkeit kaum zu überbieten – in... by pburg (25.04.07, 11:44)
Nach einem Film von Mikio Naruse
Man kann darauf wetten, dass in einem Text über Mikio Naruse früher oder später der Name Ozu zu lesen ist. Also vollziehe ich dieses Ritual gleich zu Beginn und schreibe, nicht ohne Unbehagen: Ozu. Sicher, beide arbeiteten für dasselbe Studio. Sicher, in den Filmen Naruses kann man Schauspieler wiedersehen, mit denen... by pburg (03.04.07, 22:53)
Februar 07
Anfang Februar, ich war zu einem Spaziergang am späten Nachmittag aufgebrochen, es war kurz nach 5 und es wurde langsam dunkel, und beim Spazierengehen kam mir wieder das Verhalten gegenüber den Filmen in den Sinn. Das Verhalten von den vielen verschiedenen Leuten, das ganz von meinem verschiedene Verhalten und mein... by mbaute (13.03.07, 19:49)
Berlinale 2007 – Nachträgliche Notizen
9.-19. Februar 2007 Auf der Hinfahrt, am Freitag, schneite es, auf der Rückfahrt, am Montag, waren die Straßen frei und nicht übermäßig befahren. Letzteres erscheint mir angemessen, ersteres weit weg. Dazwischen lagen 27 Filme, zwei davon, der deutsche Film Jagdhunde, der armenische Film Stone Time Touch, waren unerträglich, aber sie lagen... by filmkritik (23.02.07, 17:14)
Dezember 06, Januar 07
Im Januar hatte ich einen Burberryschal gefunden an einem Dienstag in der Nacht nach dem Reden mit L, S, V, S nach den drei Filmen im Arthousekino. Zwei Tage danach oder einen Tag danach wusch ich den Schal mit Shampoo in meiner Spüle. Den schwarzen Schal hatte ich gleich mitgewaschen,... by mbaute (07.02.07, 13:09)
All In The Present Must Be Transformed – Wieso eigentlich?
In der Kunst / Kino-Entwicklung, von der hier kürzlich im Zusammenhang mit dem neuen Weerasethakul-Film die Rede war, ist die New Yorker Gladstone Gallery ein Global Player. Sie vertritt neben einer Reihe von Bildenden Künstlern, darunter Rosemarie Trockel, Thomas Hirschhorn, Gregor Schneider, Kai Althoff, auch die Kino-Künstler Bruce Conner, Sharon... by pburg (17.12.06, 10:44)
Straub / Huillet / Pavese (II)
Allegro moderato Text im Presseheft des französischen Verleihs Pierre Grise Distribution – Warum ? Weil : Der Mythos ist nicht etwas Willkürliches, sondern eine Pflanzstätte der Symbole, ihm ist ein eigener Kern an Bedeutungen vorbehalten, der durch nichts anderes wiedergegeben werden könnte. Wenn wir einen Eigennamen, eine Geste, ein mythisches Wunder wiederholen,... by pburg (10.11.06, 14:16)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||