|
... Vorige Seite
Samstag, 26. Januar 2002
Parasiten. Etwas über Being John Malkovich von Bert Rebhandl Jede Zeit hat ihre Bilder vom Körper. Der Golem war die Figur, in der sich das frühe Kino besonders deutlich seiner magischen Qualitäten bewußt wurde: Ein Wesen, das dem Anschein nach ein Mensch war, aber nicht aus Fleisch und Blut bestand, sondern aus Lehm. Der Golem war eine Automatenphantasie, die zu früh kam. Fleisch und Blut waren die Körperzeichen des 20. Jahrhunderts. Das Fleisch wurde befreit aus den Konventionen und Kleiderordnungen, mit Marilyn Monroes berühmtem Pin-Up als Höhepunkt (die Lippen blutrot geschminkt) und mit nekrophilen Ausstellungen über Körperwelten als Gegenwart. Das Blut ist nicht nur Zeichen der Verletzlichkeit des perfekten, begehrenswerten Körpers, es ist auch das Medium der ersten biologischen Aufklärung, wie sie in dem Film "Die phantastische Reise" noch ein letztes Mal in die herkömmliche Form einer territorialen Forschungsfahrt gebracht werden konnte. Die anämischen Körper und ihre prothetischen Fortsetzungen in David Cronenbergs "Crash" deuteten ein neues Verständnis des Körperlichen an: Das Leib-Seele-Problem der abendländischen Philosophie wird von der plastischen Chirurgie aufgehoben. Diese letztendlich skulpturale Vorstellung vom Körper als Kunstwerk ist aber schon in der literarischen Vorlage zu "Crash" durch ein Medium gebrochen: Der ideale und deswegen auch idealerweise zu versehrende Körper ist der von Elizabeth Taylor, einem Filmstar. Die Identifikation verläuft über die Inszenierung von Verkehrsunfällen, bei denen die freiwilligen Opfer wie Puppen in einem Belastungstest fungieren. Der Körper wird transzendiert, indem er langsam zerstört und durch künstliche Teile ersetzt wird. Es ist eine Logik der gesteuerten Metamorphose. Der nächste konsequente Schritt, der nicht in eine virtuelle Wirklichkeit führt, wäre die Inbesitznahme eine fremden Körpers als Medium einer in anderer Form nicht zu machenden Erfahrung. In "Crash" geschieht dies noch symbolisch, durch eine kontrollierte Imitation von Zerstörungsabläufen, die auf "Being Elizabeth Taylor" hinauslaufen: Im Augenblick des Todes wird man ein Star. In "Being John Malkovich" geschieht der Übergang faktisch, durch eine Öffnung, eine Falte im Sein. Ein Portal führt in den Schauspieler John Malkovich. Der Star ist dadurch öffentlich zugänglich. Man kann die Welt mit seinen Augen sehen. Man kann als John Malkovich mit einer schönen Frau schlafen. Man kann als Frau in John Malkovich einen lesbischen Liebesakt als Mann erleben. Der Akt des "doing Malkovich" ist paradoxales Marionettentheater der höheren Art. Der Film "Being John Malkovich" beginnt mit einem Vorspiel auf dem Theater (zur Musik von Bartok) und endet als Musikvideo (zur Musik von Carter Burwell, die in den Song "Amphibian" von Björk übergeht). Das Drehbuch von Charlie Kaufman ist sehr explizit. Jedes Detail der komplizierten Verwicklungen wird erläutert, notfalls mit Illustrationen aus alten Büchern. Die Personen der Handlung geben die Formulierungen an die Hand, das Geschehen zu erklären. Es sind die Begriffe einer abendländischen Identitätsphilosophie, in denen sich sukzessive eine aktuellere Debatte um Geschlechterrollen ("gender") entfaltet, und schließlich eine absurde Idee von Reinkarnation und ewigem Leben. Zuallererst aber geht es um Rollen. Craig Schwartz (John Cusack) ist ein "puppeteer", ein Marionettenspieler. Die Figuren, die er meisterlich bewegt, stellt er selbst her. Er gibt ihnen Gliedmaßen, malt ihnen Züge ins Gesicht und kleidet sie ein. Eine Figur, bezeichnenderweise sein Double, ist nackt. Das Vorspiel auf dem Theater erzählt eine Variante des Paradiesesmythos: Ein unbekleideter Mann in einem möblierten Zimmer erlebt die Urszene der Subjektivität. Er blickt in einen Spiegel, erkennt sich selbst und erschrickt. Die Interpretation dieser Szene liefert Craig Schwartz später nach: "Consciousness is a curse." Das Bewußtsein ist ein Fluch. Das ist eine alternative Formulierung der Geschichte vom Sündenfall als Moment der Erkenntnis, mit dem ein paradiesischer Zustand der Unmittelbarkeit endete. Craig Schwartz lebt mit seiner Gefährtin Lotte in einer dunklen Wohnung, die mit dem Garten Eden wenig gemeinsam hat, aber noch Spuren des Naturzustands enthält – die Tiere, mit denen das Paar zusammenlebt, und die Tatsache, daß Craig und Lotte ein wenig verwildert sind. Es wird nicht erläutert, wohl aber angedeutet, dass dieses alternative Lebensmodell nach dem Arche-Noah-Prinzip seine besten Tage hinter sich hat. Lotte möchte ein Kind. Craigs Melancholie spricht dagegen. Er ist reif für eine neue Erfahrung anderer Art. Der Künstler, der sich in Schöpfungsakten und Inszenierungen verwirklicht, muß den Umweg über die Lohnarbeit nehmen, um aus sich heraus und zu sich selbst zu finden. Als Künstler spiegelt er sich in dem erfolgreichen Marionettenspieler Derek Mantini, der mit einer sechs Meter großen Figur der Dichterin Emily Dickinson die Aufmerksamkeit des Fernsehens auf sich zieht. Persönlich spiegelt Craig sich in seinen Marionetten. Er träumt sich in seine unbelebten Figuren hinein, will in die Haut von fremden Wesen schlüpfen, und ist sichtlich unbehaglich in seiner eigenen Rolle eines geborenen Verlierers. Lange Haare, der Bart und die Brille weisen ihn als einen Mann aus, der sich noch nicht gefunden hat. Im Gespräch wird er entweder mißverstanden, oder er redet seinem Gesprächspartner so atemlos nach dem Mund, daß er sich ständig widerspricht. Er redet, als hänge die Fortsetzung des Gesprächs an einem seidenen Faden. Lotte hat ebenfalls einen unmodischen Haarschnitt, aber sie weiß noch nichts von ihrem Unbehagen. Die Verwandlung beginnt mit einem Inserat in einer Zeitung. Ein Archivierungsunternehmen, das unwillkürlich an Kafkas Bürokratien denken läßt, sucht einen fingerfertigen Mann. Craig findet den Arbeitsplatz auf der Etage 7 1/2 eines New Yorker Hochhauses, des Merlin-Flemmer-Buildings. Die Tür des Lifts muß mit einem Brecheisen geöffnet werden, dann aber findet man einen normalen Betriebsalltag bei einer Deckenhöhe von 1.20 Meter vor. Alle finden das ganz normal. Nur die Sekretärin bestätigt die verkehrte Welt, in die Schwartz geraten ist. Sie mißversteht ihn ständig ("Mr. Juarez?"), und ist auf eine sprachschöpferische Weise schwerhörig. Der Chef entschuldigt sich für sein unverständliches Brabbeln ("indecipherable speech"), obwohl er völlig normal spricht. Die Gegebenheit des kuriosen Halbstocks etabliert eine Ordnung hinter den Spiegeln, ein Wunderland mit angedeuteten Zügen bekannter phantastischer Orte. Dazu gibt es in einem eigens eingerichteten Schauraum eine Gründungslegende dieses Halbstocks, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht: Er wurde aus Liebe zu einer kleinwüchsigen Frau errichtet. Als unmöglicher Ort ist er zugleich der Ausgangspunkt für die "übernatürlichen", dabei psychologisch völlig schlüssigen Metamorphosen aller beteiligten Personen. Schwartz macht in der Firma Lester Corp. zwei Entdeckungen: Er entdeckt sein männliches Begehren, und er findet hinter einem Aktenschrank das Portal. Das Begehren richtet sich auf die unnahbare Kollegin Maxine, deren Namen Craig in einem glossolalischen Akt errät: Er strömt förmlich aus ihm heraus, und bringt ihm eine Verabredung ein. Das Begehren wird aber auch verkörpert durch den Chef, einen rüstigen, 105 Jahre alten Mann, der unentwegt anzügliche Geschichten erzählt und in die Sekretärin Floris verliebt ist. Craig sublimiert sein Begehren, indem er eine Puppe von Maxine herstellt. Das Portal zu John Malkovich gibt seinem Begehren erst eine andere, eine konkretere Form. Nicht von ungefähr fühlt sich Lotte, als sie ebenfalls eine Malkovich-Erfahrung macht, an eine Vagina erinnert. Tatsächlich sieht das Portal eher aus wie ein Schlund. Die Außenwände sind morastig. Nach der Hälfte der Strecke entwickelt der Schlund einen Sog, wie ein Malstrom. Das "Being John Malkovich" inszeniert der frühere Musikvideoregisseur Spike Jonze als eine Reihe von kurzen Subjektivitätsclips. Die Malkovich-Besucher haben jeweils nur einen periskopischen Blick, sie beherrschen nicht das ganze Blickfeld Malkovichs. Erst mit Fortdauer der Handlung zeigt Jonze den Machtkampf in und um Malkovich auch von außen, als die spastische Bewegung, in der eine Verdrängung kurz somatisch wird: Craig verdrängt Malkovich aus sich selbst in sich selbst hinein. Craig drängt sich in Malkovich in den Vordergrund. Er errichtet sich selbst als Regime in Malkovich. Viele Formulierungen sind möglich und zutreffend. Das "Being Malkovich" dauert anfangs immer genau fünfzehn Minuten, dann werden die Besucher auf einem Abhang an der Stadtautobahn in New Jersey wieder ausgeworfen, wie eine Diskette oder ein gefallener, besser: ein geplumpster Engel. Die fünfzehn Minuten entsprechen wohl nicht zufällig der Zeitspanne, die Andy Warhols berühmtem Diktum zufolge jeder Mensch ein Star sein kann. Der Film ist aber die identitätslogische Umkehrung von Warhols Idee, denn er läuft darauf hinaus, daß jeder Mensch nicht in eigener Person selbst ein Star, sondern im Verein mit vielen anderen ein und derselbe bestimmte Star sein kann. "Wanna be someone else?" Dieses Angebot gilt nur im Zusammenhang mit John Malkovich. Es geht also nicht, wie bei Warhol, um die größtmögliche Differenzierung von Aura auf viele verschiedene Personen, sondern um die intensivste Komprimierung von Identität: Craig blickt durch Malkovichs Augen auf die Welt. Später werden mehrere Personen gleichzeitig in Malkovich sein. Eine Person kann potentiell alle Individuen in sich fassen. Die Person wäre Gott, oder der Weltgeist. Diese Überlegung ist ein Fluchtpunkt von "Being John Malkovich". Weil aber die dem Film zugrundeliegende Heilsgeschichte individualpsychologisch und medientheoretisch vermittelt ist und außerdem natürlich nicht nach Plan verläuft, endet die Sache komplizierter. "Switching bodies" bedeutet keineswegs notwendig "solving problems", wie im Film insinuiert wird, auch wenn dieser Schluß im gegenwärtigen amerikanischen Diskurs populär ist wie nie. Die Bedürfnisse schaffen sich im fremden Körper ein Medium: "Is he channeling a dead lesbian lover?", fragt Malkovichs Freund aus der Filmbranche, der völlig konträre Schauspielertyp Charlie Sheen. Sheen wird später innerhalb der logischen Chronologie der Geschichte als alter Mann Masheen "wiedergeboren" – mit Glatze. Die Bedürfnisse hängen durchwegs mit sexueller Identität zusammen, mit dem "gender", dem als Konstruktion aus sozialen und biologischen Umständen gedachten Geschlecht. Craig und Lotte sind ergänzungsbedürftig. Lotte erwähnt ausdrücklich ihre Neugierde darauf, einen Penis und eine Vagina zu haben, und begreift, während sie in Malkovich ist, daß sie transsexuell ist: "Suck my dick", herrscht sie später ihren Mann an. Sie beschließt eine Geschlechtsunwandlung. Nur Maxine genügt sich selbst. Sie verkörpert den Star im Alltag, während Malkovich den Alltag des Stars zeigt. Der Star im Alltag ist das vollkommen souveräne Wesen, autonom und bisexuell, geschäftstüchtig und pragmatisch, attraktiv und gefühlsintensiv. Der Alltag des Stars hingegen ist die nackte Profanität: Malkovich unter der Dusche, Malkovich bei der Bestellung einer Badezimmermatte, Malkovich mit weißen Socken und Slippers auf dem Fauteuil. Auf Maxine, nicht auf Malkovich, konzentrieren sich alle Energien und Wünsche: Craigs Sehnsucht nach einem aufregenden Leben, Lottes Sehnsucht nach einer existenziellen Komplettierung, schließlich sogar Malkovichs Sehnsucht danach, überhaupt ein Leben zu haben. Als Star existiert er nur in einem Zwischenreich. Die Menschen erinnern sich vage an seine Filmrollen, der Part eines Juwelendiebs wird ihm irrtümlich zugeschrieben. Die von einem Gast in einem Restaurant erwähnte Rolle ist der einzige Verweis auf Malkovichs Karriere und bezieht sich ausgerechnet auf die Darstellung eines Behinderten. Die Komik von "Being John Malkovich" resultiert aus einer absurden Kreuzung verschiedener Entwicklungsromane. Einer dieser Romane wird nur knapp angedeutet und gibt dem Geschehen eine naturgeschichtliche Dimension: Der Schimpanse Elijah leidet wegen eines Kindheitstraumas an Sodbrennen und muß deswegen zur Psychoanalyse. In einem besonders überraschenden Subjektivitätsclip zeigt Jonze das Trauma des Schimpansen (es ist die Gefangennahme Elijahs und seiner Familie durch menschliche Jäger im Dschungel), und eine Reaktion des Tiers darauf, die als Lernprozeß begreifbar ist: Elijah löst die Fesseln der von Craig gefangengesetzten Lotte. Die evolutionsgeschichtliche Nachbarschaft des Affen zum Menschen wird konkret in einem Pakt, der sich gegen Craig, den Schöpfer, richtet. Das Ende des Film deutet dann eine noch weiterreichende Verbindung der Lebewesen an. Maxine und Lotte haben zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsames Kind (das Lotte als Malkovich gezeugt hat). Es trägt den Namen Emily, tritt also in demiurgische Konkurrenz mit Mantinis Puppe zu Beginn. Der Abspann zeigt Emily unter Wasser in einem lichtdurchfluteten Pool. Björks Nummer "Amphibian" folgt auf diese Szene wie eine Erläuterung, angedeutet wird die Idee eines vorbewußten Zustands, eines uteralen Schwimmens vor der Differenzierung, die das Bewußtsein bringt. Die Aufhebung des Fluchs. Das Bewußtsein führt die Unterscheidungen ein, der Star bekräftigt die Unterscheidungen systematisch und führt zugleich die zur Zeit wichtigste dieser Unterscheidungen erst ein: Subjekt oder Objekt des Mediums zu sein. Der Star ist auf eine prekäre Weise beides, deswegen ist es auch das "Being John Malkovich", worüber sich alles vermittelt, und deswegen muß auch Craig, wenn er von Malkovich endgültig Besitz ergreift, den Star neu erfinden – als Regisseur, als Fädenzieher, als Puppenspieler John Horatio Malkovich. Es ist Craigs Entwicklungsroman, der sich hier durchsetzt: Die Manipulationsphantasie eines Kleinkinds, das seine Größenphantasien in der Bastelstube auslebt, und Enttäuschungen nicht verwinden kann. In vielerlei Hinsicht ist die Geschichte von "Being John Malkovich", die gegen Ende von einem Beteiligten ausdrücklich als "travesty" bezeichnet wird, eine Travestie auf den "Wizard of Oz", den archetypischen Entwicklungsroman des amerikanischen Kinos. Während das Musical davon handelt, in Dorothys Leben ein Realitätsprinzip – die Umstände in Kansas - durchzusetzen, handelt Spike Jonzes Film von den entfesselten Wunschenergien der Subjektivität: Das zeigt sich an der Form der Clips, die zu Beginn einfache Point-of-View-Aufnahmen sind und mit den Komplikationen der Handlung immer absurdere Form annehmen. Höhepunkt ist die Begegnung Malkovichs mit sich selbst, ein Zu-Sich-Kommen in einem Kosmos endloser Selbstbezüglichkeit, in dem alle Rollen von Malkovich gespielt werden und es keinen anderen Begriff gibt außer "Malkovich". Selbst die Speisekarte im Restaurant bietet nur ein Malkovich-Menü an, die attraktive Sängerin, die sich auf dem Klavier räkelt, ist Malkovich. Der zweite Höhepunkt ist die Verfolgungsjagd von Maxine und Lotte in Malkovichs Unbewußtem, das hier ausdrücklich als "subconscious" gefaßt wird und eine kubistisch verschobene Welt mit wilden Achsensprüngen und gekippten Räumen enthält, in dem sich die Urszenen der geläufigen Traumapsychologie wiederholen: Malkovich beobachtet die Eltern beim Liebesakt, Malkovich macht sich in die Hosen. "Little Johnnie Malkopee" singen die Kinder im Schulbus. Sie stimmen damit auch in das Spiel der Verballhornungen des Malkovich-Namens ein, das seinen Höhepunkt am Ende erreicht, wenn Malkovich als Subjekt endgültig ausgelöscht ist und buchstäblich ein Altenheim geworden ist: "Malcatraz" ist zu einem "vessel" geworden, einem Gefährt, in dem eine Gruppe Menschen dem Tod ein Schnippchen schlägt und auf ein nächstes "Fahrzeug" wartet. Dieses nächste "vessel" ist das Mädchen Emily, das aber bereits einen unerkannten Bewohner hat. Es ist Craig, der als Tochter von Maxine und Lotte nicht nur das Geschlecht getauscht hat, sondern auch zu sich selbst gekommen ist: Er ist wieder das Kind, das von der sexuellen Konkurrenz und Differenz erlöst ist und um seiner Unschuld wegen geliebt und genährt wird. Craig ist im Paradies angekommen, indem er endgültig zum Parasiten geworden ist. filmkritik, 26. Januar 2002 um 23:52:42 MEZ ... Link Donnerstag, 6. Dezember 2001
The Lexikon of Love "Moulin Rouge" von Baz Luhrman Von Michael Girke K wie Künstlichkeit: Eine Vorhangpracht öffnet sich, um das bekannte Zeichen der 20th Century Fox preiszugeben, die Kamera fliegt durch ein altes Paris und kommt in der Stube eines armen Poeten an. Ab der ersten Sekunde fegt "Moulin Rouge" jede Illusion von Realismus aus dem Kino. Und bietet statt Tänzern ein Heer von Tänzern, statt Kulissen ein Kulissenmeer, statt Referenzen ein Referenzengewitter auf. Wenn Kitsch, dann bitte verschwenderisch. Kitsch ist immer einen Schritt von Lächerlichkeit entfernt. Wenn es nicht hinhaut, wirkt Film wie eine Überdosis Eierlikör. Geht es gut, springt für den Zuschauer eine der drei herzerwärmenden Emotionen heraus: Feeling Whoopi. S wie Singen: Einer der schlimmsten Momente in TV und Kino: Emotionen, die keiner hat, vorgetragen in Form abgestandener Tanzeinlagen. Danach fühlen Hirn und Herz sich an wie Eintopf aussieht. Altern hat nur Nachteile und einen Vorteil: Reife Menschen können unterscheiden zwischen miesen und guten Tanzfilmen. Wenn Fred Astaire singt und stept, werden Welt und Liebe federleicht, wenn Bing Crosby oder Marika Röck raspeln und hüpfen, verlieren Betrachter ihre Sexualität. Das Baz Luhrman ein Guter ist, erkennt man schon daran, das er die Nichtsänger Nicole Kidman und Ewan McGregor an all die großen Songs lässt. Das ist so bezaubernd wie Punk bezaubernd war. Dagegen ist der professionelle Pomp heutiger Musicals (Cats, Phantom der Oper) so interessant anzuschauen wie der Reifeprozess linksdrehender Joghurtkulturen. H wie Handlung: Ein armer Poet im Paris von 1900 erträumt sich eine Liebe mit einer Hure. Die Liebe erlöst mal wieder von Armut, Prostitution und Showgeschäft, um dann mal wieder tödliche Folgen für weibliche Teilnehmer zu haben. Ein, ähem, übersichtlicher Plot. Raum für Luhrman wirklich alle bekannten und unbekannten Liebes-, Kunst- und Modernemythen zu verarbeiten. So könnte man "Moulin Rouge" beschreiben. Ergiebiger wäre ein Versuch all die Schnitteskapaden, Kameramorphings, Effekteballette und Farbdramaturgien in Worte zu fassen. Dazu nehmen wir einige Zeilen aus dem Blumfeld-Song "Walkie Talkie": "Die Häuser kriegen leuchtende Augen/ Rot gibt den Weg frei und verschwindet/ selbst Gelb gerät in einen Taumel/ vergießt sich Blau und möchte Rot sein/ hüllt sich in Weiß ein und erblindet." Verrühren Sie Ihre zu diesen Zeilen entwickelten Phantasien mit einem gerüttelt Maß an hysterischem Willen zu Vergnügen, Verspieltheit und Rausch, atemlosen Kunstfanatismus und einer Computeranimation mit Schwindel- und Kreischfaktor 12. Jetzt ist ihre Vorstellungskraft nur noch einige Meter entfernt von einer Sekunde dieses Films. D wie Dekors: "Es gibt das Paris der Paramount, das Paris von MGM und das Paris in Frankreich. Unter diesen dreien ist das Paris von Paramount das pariserischste." So sah es Ernst Lubitsch. "Moulin Rouge" beerbt mit Vincente Minnelli den Könner unter den Musical-Regisseuren. Und somit all jene grandiosen Hollywooddekors, die das Image von Paris massenwirksamer geprägt haben als Paris selbst es vermochte. Und so lässt "Moulin Rouge" "Die Welt der Amélie" aussehen wie einen Flohmarkt für die trübtassigen Parisklischees niedlichkeitssüchtiger Schwachköpfe. P wie Postmoderne: Es gehen immer noch Leute auf geistige Barrikaden, wenn Kunstwerke die Quellen ihrer Inspiration, ihre Geklautheit offen ausstellen. Das wird als Symptom der zu Ernst und Originalität unfähigen Postmoderne diagnostiziert. Solche Diagnosen lesen sich wie Einsatzbefehle, als solle Kunst gefälligst strammstehen vor einer Aufgabe, die ihr zugewiesen wird. An einer zentralen "Moulin Rouge-"Stelle zitiert McGregor all die Liebesmanifeste der Popmusik ("All you need is love", "Love lifts us up where we belong" etc.), Kidman macht diese lächerlich. Wer sich und andere je genau beobachtet hat, weiß, was man als Liebe denkt, ist nichts als Songzeile, Filmbild, Angelesenes, Klischee. Wer einen Film wie "Moulin Rouge" bloß postmodern nennt, ist nicht nur blind für den auch in kitschigstem Kitsch und zitiertester Zitatkunst möglichen Realismus, mehr noch, sein Ernst und seine Originalität entsprechen exakt der Oberflächlichkeit und unreflektierten Reproduktion von Bekanntem die er bei Filmen verurteilt. T wie Tradition: Ist nicht ein magischer Kindheitsmoment das Öffnen einer Wundertüte? "Moulin Rouge" ist eine Wundertüte für alle, eine, in der das ganze 20. Entertainment-Jahrhundert Platz hat. Famos wie David Bowies "Heroes", TRex "Children of the Revolution", Nirvanas "Smells like Teen Spirit" und Techno gemixt werden zu einem Plädoyer für Bühnenmagie, Pop und Verschwendung, allem, was das Leben im 20. Jahrhundert erträglich gemacht hat. "Moulin Rouge" verhält sich zum verordneten Ernst der Gegenwart wie diese tänzerisch-doppeldeutigen Zeilen von Gottfried Benn sich zum verordneten Ernst der 50er verhielten: "Immer nur diese pädagogischen Sentenzen/ eigentlich ist alles im männlichen Sitzen produziert/ was das Abendland sein Höheres nennt – ich aber bin wie gesagt für Seitensprünge." mbaute, 6. Dezember 2001 um 22:47:37 MEZ ... Link Dienstag, 4. Dezember 2001
Fernsehen auf großer Leinwand? Michael Althen, Andreas Kilb, Peter Körte, Bernd Eichinger und Nico Hofmann unterhalten sich aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.11.2001, Nr. 278 / Seite 61 Dem deutschen Kino geht's gut, sagen die Zahlen. Fast achtzehn Prozent betrug der Marktanteil deutscher Filme bislang im Jahr 2001, und "Der Schuh des Manitu" steuert auf den zehnmillionsten Besucher zu. Das deutsche Kino gibt es gar nicht mehr, es wird vom Fernsehen aufgefressen, sagt nicht nur der Regisseur Romuald Karmakar. Beides trifft so nicht zu, widersprechen Bernd Eichinger und Nico Hofmann. Der zweiundfünfzigjährige Eichinger ist der erfolgreichste deutsche Filmproduzent. Von "Der Name der Rose" bis zu "Das Geisterhaus" hat er zahlreiche internationale Kinoproduktionen zustande gebracht, mit den "Werner"-Filmen und "Ballermann 6" deutsche Kassenerfolge produziert, gelegentlich selbst Regie geführt (fürs Fernsehen "Das Mädchen Rosemarie", fürs Kino "Der große Bagarozy"), aber auch fürs Fernsehen produziert ("Opernball", 1998, oder "Vera Brühne", 2001). Als fünfundzwanzigprozentiger Teilhaber der börsennotierten Constantin Film AG ist Eichinger zudem als Verleiher erfolgreich. Der einundvierzigjährige Nico Hofmann hat als klassischer Autorenfilmer ("Land der Väter, Land der Söhne", 1989) begonnen und sich später mehr und mehr aufs Fernsehgeschäft verlegt. Als Regisseur drehte er unter anderem "Der Sandmann" (1995) und den Kinofilm "Solo für Klarinette" (1998). Als Geschäftsführer der Firma teamWorx hat Hofmann zuletzt Fernsehmehrteiler wie "Der Tunnel" und "Tanz mit dem Teufel" produziert. F.A.Z. Romuald Karmakar hat im Interview mit dieser Zeitung kürzlich gesagt: "Es gibt kein deutsches Kino mehr." In welcher Funktion sind Sie beide denn heute hier, wenn diese Aussage zutreffen sollte? EICHINGER: Wenn ich will, verstehe ich, was Karmakar meint. Wir müssen aber erst mal eine Definition finden, was deutscher Film überhaupt ist. Denn es gibt ja auch nicht den amerikanischen Film, da die Filmemacher in Hollywood aus der ganzen Welt kommen. Prinzipiell ist Kino ein viel globaleres Unternehmen, als daß es territorial abzugrenzen wäre. Karmakar beschwert sich darüber, daß es bestimmte Themen nicht gibt. Was er beklagt, ist das Fehlen eines Kinos, das über die Befindlichkeiten in Deutschland berichtet. Da kann man natürlich mit Recht fragen, warum das so ist. Und da kommen wir zum Hauptpunkt. Wenn man in die Geschichte des eigenen Landes geht, dann hat man es, speziell wenn es in die Vergangenheit geht, mit Sujets zu tun, die nicht mehr zu bewältigen sind. Man kann mit dem Budget, das man hier maximal zusammenbekommt, also etwa zehn Millionen Mark, keinen Film über die siebziger Jahre mehr ausstatten. Warum bekommt man denn nicht mehr als zehn Millionen Mark? EICHINGER: Weil die Begrenztheit des deutschsprachigen Marktes eine Refinanzierung sonst unwahrscheinlich macht. Was ist mit der Filmförderung? EICHINGER: Sie ist nicht ausreichend. Das ist doch eine furchtbare Situation. EICHINGER: Ja, wenn man diese Filme haben will, dann müssen Bund und Länder sie, ähnlich wie das beim Theater passiert, massiv unterstützen. Es gibt Beispiele aus Frankreich, wie man das macht. Das Fernsehen trägt in Frankreich wie übrigens auch in anderen europäischen Ländern ungleich mehr zur Finanzierung von Kinofilmen bei. Man kann daher in Frankreich Budgets von bis zu zwanzig oder dreißig Millionen Mark zusammenbekommen. Mit solchen Budgets können auch wir in Deutschland herausragende Filmwerke machen, wie beispielsweise "Das Boot" gezeigt hat. Sonst bleibt uns im Prinzip nur das Genre der Komödie, die man für relativ billiges Geld herstellen kann. Ich rede da nicht nur von materiellem Aufwand, sondern von Genauigkeit, Ruhe und Präzision bei der Arbeit - also Zeit. Wir rechnen hierzulande mit maximal 45 Drehtagen für einen Film. Der vielgerühmte französische Film "Amélie" hatte hingegen 90 Drehtage - und die Hälfte davon hat das Fernsehen bezahlt. Sicherlich, Frankreich hat ein zentralistisches System. Bei uns liegt die Kulturhoheit nun mal bei den Ländern. Wenn man sich hier aber zu der Überzeugung durchringen könnte, daß Film ein wichtiges nationales Gut ist, wird man dafür auch entsprechende Gesetze und Voraussetzungen schaffen. Wer soll denn diese Überzeugung haben - Herr Nida-Rümelin, der Kulturstaatsminister? Die Länderförderungen? EICHINGER: Man kann das nicht an Personen festmachen. Man kann nicht einfach sagen: Da ist der Nagel, da schlag' ich ihn rein - Problem gelöst. Es ist ein spezifisch deutsches Problem, daß der Film im Verhältnis zu Theater oder Oper nicht als gleichrangige Kunstform angesehen wird. Natürlich ist da auch ein Kulturminister aufgerufen, daran etwas zu ändern. HOFMANN: Es ist auch wichtig zu sehen, daß man in Frankreich beispielsweise eine völlig andere Tradition hat im Verhältnis zwischen Publikum, Markt und Kino als in Deutschland. Ich glaube, daß die deutsche Filmgeschichte intervallartig abläuft. Es gab eine Ära Fassbinder, fast eine Ära Karmakar, es gab kommerziellen Neubeginn mit Wolfgang Petersen oder Sönke Wortmann, also ein ständig wechselndes Muster, was Tendenzen betrifft. Ich empfinde die Kinotradition in Frankreich als viel gewachsener. Übrigens auch das Zusammenspiel zwischen Presse, Kritik, dem Publikum und den Filmemachern selbst steht in einer völlig anderen Wertschätzung, auch im populären Bereich. Eine ganz wesentliche These Karmakars war ja: Gewisse Filme finden im Kino gar nicht mehr statt. Und gewisse Programme werden plötzlich vom Fernsehen produziert. Ich nehme ein Produkt aus unserem Hause: Wir haben zum Beispiel den neuen Christian-Petzold-Film "Toter Mann" produziert. Dieser Film hat 2,35 Millionen Mark gekostet und ist eine reine teamWorx-Auftragsproduktion für das ZDF. Wir haben gemeinsam mit dem ZDF die Kinokopie für Hof finanziert ohne jede Förderung. Auch "Der Tunnel" ist ohne Kinogeld nur mit Mitteln der Fernsehfilmförderung produziert und erweist sich geradezu als Exportschlager - auch im Kinobereich. Man sieht daran, wie verrückt der Markt funktioniert. Und meine These ist ja, daß im Moment die interessanten Projekte teilweise im Fernsehbereich ablaufen. Helfen denn Produktionen wie "Der Tunnel" oder "Vera Brühne" dem deutschen Film überhaupt weiter? HOFMANN: Ich finde die Frage komplexer. Denn beide sind beachtliche Filme. Spannender finde ich zu definieren, welche Art Film wir uns vorstellen, wenn wir vom "deutschen Film" sprechen. Es gibt einen Unterschied zwischen "Aimée und Jaguar" und dem "Boot" in der Zielrichtung internationaler Markt. Man muß definieren, für welchen Markt, für welchen Anspruch diese Filme gemacht sind. Und man kann die ketzerische Frage stellen: Wäre "Aimée und Jaguar" anders oder besser geworden, wenn der Film zehn Millionen Mark mehr Budget gehabt hätte? Oder wäre "Der Tunnel" ein anderer Film geworden, wenn er zwanzig Millionen Mark mehr Budget gehabt hätte? Ich würde die Frage nicht ultimativ mit Ja beantworten. Ich will nur auf eine neue Wertigkeit bei der Betrachtung der Budgets zwischen hochkarätigen Fernseh-Events und deutschen Kinofilmen hinweisen. Dazu kommt: Der französische Fernsehmarkt beispielsweise ist erbärmlich schwach. Wir exportieren zur Zeit unsere ganzen Produkte nach Frankreich. Der deutsche Fernsehmarkt ist unendlich stark geworden in den letzten sechs, sieben Jahren. Mittlerweile sieht jedes mittelmäßige Pro7-TV-Movie fast besser aus als hochwertig geförderte Kinofilme. Heißt das: Das Kino steigt ab und das Fernsehen auf? EICHINGER: Wir können hier reden, solange wir wollen, Tatsache bleibt, daß mehr Geld investiert werden muß, wenn es eine kontinuierliche Kinokultur in Deutschland geben soll. Bei uns sieht man jede Person, die man im Fernsehen sieht, auch im Kino. Es gibt keine Trennung. Das wäre aber wichtig. Jeder Kinoregisseur kann zwar mal einen Fernsehfilm machen wollen, aber er muß vom Kino leben können. Eine Callas kann nicht abends in der Mailänder Scala singen und am Vormittag in irgendeiner Operette auf dem Land. HOFMANN: Das ist ja gerade der Unterschied zu Amerika. Dort wird eine genaue Segmentierung vorgenommen: Serie, movie of the week, event movie und Kino. Und es ist ganz klar, daß Überschneidungen in der Karriereplanung von Schauspielern es unmöglich machen, daß jemand in einer kleineren TV-Produktion spielt und gleichzeitig im nächsten Spielfilm von Scorsese mitwirkt. Bei uns in Deutschland leben aber 80 Prozent aller Beschäftigten in diesem Markt vom Fernsehen, und das Fernsehen dominiert auch den Starkult. EICHINGER: Im Fernsehen sieht man sehr deutlich, um was es geht. Auf der ganzen Welt arbeiten die Fernsehanstalten mit fast demselben Geld. Ein durchschnittlicher Fernsehfilm, der in Amerika hergestellt wird, kostet ähnlich viel wie ein Fernsehfilm in Deutschland. Und siehe da: Dort, wo man standhalten kann, wo man im gleichen ökonomischen Umfeld arbeitet, sagt das Publikum plötzlich: Wir möchten aber viel lieber die deutschen Produktionen sehen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, daß das, wenn eine gewisse Ausgewogenheit da wäre, nicht auch im Kino gelingen würde. Wann immer ein deutscher Kinoregisseur einen Film drehen will, ist das Fernsehen schon da. Die Filme, die dann fürs Kino gemacht werden, sind in ihrer Dramaturgie und Ästhetik völlig vom Fernsehen imprägniert. Wie soll man da rauskommen? HOFMANN: Es sind zwei Dinge bemerkbar: Der Kinomarkt ist heute viel schwieriger geworden als noch vor drei, vier Jahren. Das hat damit zu tun, daß es immer weniger Verleiher gibt. Und am wenigsten sind jene Kinoverleiher übriggeblieben, die riskante Arthaus-Projekte ins Kino bringen. Plötzlich fühlen sich die Sender auch notgedrungen für den Arthaus-Bereich zuständig: Sie sind die letzte Bastion, wenn es um die Finanzierung solcher Projekte geht. Und diese Segmentierung ist interessant, die gibt es in Frankreich überhaupt nicht. Dort hat man den populären Film neben dem anspruchsvollen im Kino, und das hat übrigens auch mit der Filmkritik zu tun. Es gibt doch aber Filme, die verrissen wurden und erfolgreich waren, während andere, die hoch gelobt wurden, beim Publikum durchfielen. HOFMANN: Ich bin überzeugt davon, daß Kritiken Auswirkungen haben auf den Erfolg eines Kinofilms. Ohne ein großes Bündnis, durchaus ein kritisches, gelangt man im Moment mit einem deutschen Programm weder im Fernsehen noch im Kino zum Erfolg. Es gibt in Deutschland eben Kunstfilme, dazu braucht es die Kritik. Es gibt Komödien und populäre Stoffe wie "Werner beinhart" und "Das kleine Arschloch" - alles wunderbare Filme -, die brauchen keine Kritik. EICHINGER: Gut, man braucht die Kritik beim "Schuh des Manitu" nicht, aber ich fand es schade, daß gar keine stattgefunden hat. Wie kann das sein, daß so ein Phänomen im Feuilleton überhaupt nicht stattfindet? Es gibt immer wieder anspruchsvolle Filme in Deutschland und andererseits kommerzielle Filme wie "Der Schuh des Manitu", die sehr erfolgreich sind. Zwischen diesen beiden Polen, zwischen denen sich der deutsche Film seit dreißig Jahren bewegt, gibt es eine Form, die mittlerweile im Kino gar nicht mehr existiert, und das ist der Krimi. Warum gibt es in Deutschland keine Krimis? HOFMANN: Meine These ist, daß ausgerechnet dieses Genre vom Fernsehen seit dreißig Jahren mit am erfolgreichsten besetzt wurde. Der "Tatort" ist ein Klassiker, aber in den letzten fünf Jahren wurde der Markt regelrecht mit Thrillern und Krimiserien überschwemmt. Inzwischen ist das etwas abgeflaut, die Leute wollten mehr Romantic Comedy und Love-Stories. Langsam steigt das Interesse an Krimis wieder, aber diesen Trend sehe ich ausschließlich im Fernsehen. Ist dem anspruchsvollen Film denn dadurch geholfen, daß der "Schuh des Manitu" zehn Millionen Zuschauer hat? Fließt irgend etwas von dem Geld oder der Risikobereitschaft zurück? Oder der Achtungserfolg vom "Tunnel" im Ausland: Wird der irgend etwas bewirken? EICHINGER: Mit jedem erfolgreichen Projekt hat man etwas mehr Luft für was Neues. Es stärkt das Selbstbewußtsein. Wenn man eine schlechte Phase hat, wird man immer zögerlicher, wenn man aber gut ist, wird man immer aggressiver, weil man sagt: Jetzt wird das probiert. Und aus dieser Aggressivität entsteht ja auch viel Gutes. HOFMANN: Ich möchte noch eines ergänzen: Das eine ist die klare kommerzielle Linie, daß der Produzent sagt, ich muß Geld verdienen, um andere Projekte finanzieren zu können. EICHINGER: Also, ich weiß bis heute im voraus nicht, was kommerziell ist. HOFMANN: Ich nehme meine "Tunnel"-Einnahmen aus dem Ausland, die erklecklich sind, und stecke sie in neue Projekte, beispielsweise in den neuen Film von Christian Petzold, den wir im nächsten Jahr produzieren. Die Frage aber, ob Sie als Produzent generell mit ausschließlich einer Produktlinie "künstlerischer Film" überleben können, die würde ich mit Nein beantworten. Der Produzent, der sich ein Jahr seines Lebens nur einem einzigen künstlerischen Projekt verschreibt, den gibt es immer seltener. Sie brauchen mittlerweile ein breites Produktionsportfolio - vom "Tunnel" über die Oetker-Entführung "Der Tanz mit dem Teufel" bis zu "Toter Mann" von Petzold als rein künstlerischem Film -, um zu überleben. Womöglich muß man sich mal von der Illusion trennen, es gebe hierzulande unglaublich viele verheißungsvolle Projekte, die wegen der Ignoranz von diversen Geldgebern nicht zustande kommen. Im Grunde geht Herr Eichinger ja noch weiter, indem er sagt, es gebe immer noch zu viele deutsche Filme, die ins Kino kommen, ohne Chancen zu haben. Wie kann man das ändern? EICHINGER: Ich glaube wirklich, man muß die Produktion runterfahren. Man muß doch die Förderung so ändern können, daß es mehr gute Filme gibt. EICHINGER: Im Moment haben die allermeisten Produzenten nicht die Möglichkeit, ihre Filme selbst zu "greenlighten". Sie können Stoffe nur vorschlagen, und zwar dem Fernsehen und den Förderungsgremien. Wenn einer von beiden nein sagt, kann der Film nicht gemacht werden. Also werden nur Stoffe vorgeschlagen, wo das wahrscheinlich ist. Dem könnte man zum Beispiel durch eine drastische Erhöhung der Referenzmittel beikommen, sonst sehen wir im Kino nur, was ohnehin auch im Fernsehen läuft. HOFMANN: Ich finde die neue Experimentierfreude bei den Sendern in den letzten Jahren sehr erfreulich. Es ist toll, daß jetzt auch Fernsehredakteure Lust auf einen Dogma-Film bekommen und diese Formen unterstützen. Die neuen Nachwuchsfilme haben eine gewisse Radikalität. Benjamin Quabecks "Nichts bereuen", eine Koproduktion des WDR, oder Stefan Krohmers vielbeachtete ARD-Arbeit "Ende der Saison" gehören hier dazu. Solange diese Nachwuchspflege stattfindet, funktioniert das Zusammenspiel mit den Sendern durchaus. Ich plädiere allerdings für eine viel klarere Trennung zwischen Fernsehmarkt und Kinomarkt. Wenn Kulturstaatsminister Nida-Rümelin sagt, Film müsse stärker als ein Kulturgut wahrgenommen werden - was halten Sie davon? EICHINGER: Das ist schon ein Signal in die richtige Richtung. Natürlich ist Film ein Kulturgut. Wenn man will, daß Leuten im Kino etwas über das Bewußtsein eines Landes berichtet wird, muß man etwas dafür tun. Sonst wird das alleine Sache des Fernsehens - was im Prinzip ohnehin schon der Fall ist. Auch unter dem Aspekt muß man das Kartell der Fernsehsender endlich mal beleuchten. HOFMANN: Die deutschen Sender fühlen sich unheimlich selbstbewußt, weil sie wissen, daß sie achtzig Prozent des Film- und Fernsehmarktes dominieren. Die Intendanten der großen Sender würden auf Nachfrage stolz sagen, daß der cineastische Kulturbegriff in Deutschland sehr stark durch das Fernsehen geprägt ist. Gerade hier brauchen wir aber wieder eine gesunde Trennschärfe: Was ist ein TV-Movie, ein großer TV-Event, und was ist wirklich großes Kino? Und wenn wir dann von Kino sprechen, dann sollte allen Senderchefs klarwerden, daß sie an hochwertigen Kinoproduktionen ein genauso großes Interesse haben sollten wie zum Beispiel Canal+ in Frankreich, ein Sender, der sich mit sehr viel mehr Geld an großen Kinofilmen beteiligt, als wir das in Deutschland gewohnt sind. EICHINGER: Die Trennung zwischen Kino und Fernsehen muß auch redaktionell stattfinden. Man kann keinen Fernsehredakteur auf ein Kinoprojekt ansetzen. Es entstehen auf diesem Weg doch bestimmte Ideen gar nicht erst. Man muß den Einfluß zurücknehmen, den das Fernsehen auch auf die Verteilung der Fördergelder nehmen kann. Es wird viel getan bei den Sendern, es gibt durchaus Freiheiten - und trotzdem muß eine Trennung vom Kino stattfinden. Es ist ein unglaublich filigranes Gefüge, einen Kinofilm zu machen. Wenn eine Winzigkeit nicht stimmt, ist im Kino sofort die Luft raus, kann aber im Fernsehen trotzdem noch gutgehen. Das Gespräch führten Michael Althen, Andreas Kilb und Peter Körte. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.11.2001, Nr. 278 / Seite 61 mbaute, 4. Dezember 2001 um 01:49:52 MEZ ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8844 Days
last updated: 10.04.14, 10:40  Youre not logged in ... Login

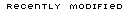 Danièle Huillet – Erinnerungen, Begegnungen
NICHT VERSÖHNT (1965) *** Jean-Marie Straub – Danièle und ich sind uns im November 1954 in Paris begegnet – wir erinnern uns gut daran, weil das der Beginn der algerischen Revolution war. Ich war mehrmals per Autostop nach Paris gekommen, um Filme zu sehen, die es bei uns nicht gab, LOS... by pburg (05.10.07, 11:58)
UMZUG
Nach knapp 2000 Tagen bei antville und blogger machen wir ab jetzt woanders weiter. Unter der neuen Adresse http://www.newfilmkritik.de sind alle Einträge seit November 2001 zu finden. Großer Dank an antville! Großer Dank an Erik Stein für die technische Unterstützung! by filmkritik (08.05.07, 15:10)
Warum ich keine „politischen“ Filme mache.
von Ulrich Köhler Ken Loachs „Family Life“ handelt nicht nur von einer schizophrenen jungen Frau, der Film selbst ist schizophren. Grandios inszeniert zerreißt es den Film zwischen dem naturalistischen Genie seines Regisseurs und dem Diktat eines politisch motivierten Drehbuchs. Viele Szenen sind an psychologischer Tiefe und Vielschichtigkeit kaum zu überbieten – in... by pburg (25.04.07, 11:44)
Nach einem Film von Mikio Naruse
Man kann darauf wetten, dass in einem Text über Mikio Naruse früher oder später der Name Ozu zu lesen ist. Also vollziehe ich dieses Ritual gleich zu Beginn und schreibe, nicht ohne Unbehagen: Ozu. Sicher, beide arbeiteten für dasselbe Studio. Sicher, in den Filmen Naruses kann man Schauspieler wiedersehen, mit denen... by pburg (03.04.07, 22:53)
Februar 07
Anfang Februar, ich war zu einem Spaziergang am späten Nachmittag aufgebrochen, es war kurz nach 5 und es wurde langsam dunkel, und beim Spazierengehen kam mir wieder das Verhalten gegenüber den Filmen in den Sinn. Das Verhalten von den vielen verschiedenen Leuten, das ganz von meinem verschiedene Verhalten und mein... by mbaute (13.03.07, 19:49)
Berlinale 2007 – Nachträgliche Notizen
9.-19. Februar 2007 Auf der Hinfahrt, am Freitag, schneite es, auf der Rückfahrt, am Montag, waren die Straßen frei und nicht übermäßig befahren. Letzteres erscheint mir angemessen, ersteres weit weg. Dazwischen lagen 27 Filme, zwei davon, der deutsche Film Jagdhunde, der armenische Film Stone Time Touch, waren unerträglich, aber sie lagen... by filmkritik (23.02.07, 17:14)
Dezember 06, Januar 07
Im Januar hatte ich einen Burberryschal gefunden an einem Dienstag in der Nacht nach dem Reden mit L, S, V, S nach den drei Filmen im Arthousekino. Zwei Tage danach oder einen Tag danach wusch ich den Schal mit Shampoo in meiner Spüle. Den schwarzen Schal hatte ich gleich mitgewaschen,... by mbaute (07.02.07, 13:09)
All In The Present Must Be Transformed – Wieso eigentlich?
In der Kunst / Kino-Entwicklung, von der hier kürzlich im Zusammenhang mit dem neuen Weerasethakul-Film die Rede war, ist die New Yorker Gladstone Gallery ein Global Player. Sie vertritt neben einer Reihe von Bildenden Künstlern, darunter Rosemarie Trockel, Thomas Hirschhorn, Gregor Schneider, Kai Althoff, auch die Kino-Künstler Bruce Conner, Sharon... by pburg (17.12.06, 10:44)
Straub / Huillet / Pavese (II)
Allegro moderato Text im Presseheft des französischen Verleihs Pierre Grise Distribution – Warum ? Weil : Der Mythos ist nicht etwas Willkürliches, sondern eine Pflanzstätte der Symbole, ihm ist ein eigener Kern an Bedeutungen vorbehalten, der durch nichts anderes wiedergegeben werden könnte. Wenn wir einen Eigennamen, eine Geste, ein mythisches Wunder wiederholen,... by pburg (10.11.06, 14:16)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||