|
... Vorige Seite
Samstag, 25. März 2006
Heide Schlüpmann, "Öffentliche Intimität. Die Theorie im Kino" Frankfurt am Main / Basel (Stroemfeld Verlag) 2002. Von Johannes Beringer Der vielleicht 'zentralste Satz' in diesem Buch ist für mich: "Über der Hingabe der Theorie an die Filme kehrt ihm sein Erkenntnisvermögen in neuer Gestalt wieder." (Über den 'Außenseiter der Theorie' Siegfried Kracauer.) Es geht in "Öffentliche Intimität" zwar auch um Siegfried Kracauers "Theorie des Films" - und in einer Weise, wie man es noch nie gehört hat -, aber Kracauer ist hier eher 'Mittler' (oder 'Passeur' in Serge Daneys Sinn): um sich von dem, was heute Philosophie und Theorie heißt, abzukehren und die Kinoerfahrung vom Dunkel ins Licht der Erkenntnis zu heben. "Das Dunkel ist das vielleicht am wenigsten beachtete Moment des Kinos ..." (S. 113) Die Verstrickung in die Philosophie bleibt natürlich bestehen (die Autorin kann ihre Lebensgeschichte nicht einfach ablegen oder negieren) - aber es geht, bekenntnishaft und durch geschichtlichen Aufriss, vor allem auch darum, zu sehen, was durch sie verhindert worden ist. Schreibend 'zu sehen', am 'Leitfaden des Leibes' und am 'Leitfaden der Liebe' (in einem gegenüber früher vielleicht geläuterteren Schreiben). Tatsächlich ist bislang die 'Faszination des Kinos', die ja (trotz neuer Medien) bis heute anhält, zwar 'deklariert' worden und doch einigermaßen unerklärt geblieben. Es gab und gibt diejenigen, die vom 'Virus' befallen sind, und die 'sich erkennen' (wie wenn sie einem losen Geheimbund angehörten) - was nicht zuletzt daher rühren könnte, dass ihre Leidenschaft einen unerklärten oder verschwiegenen Kern hat. In Heide Schlüpmanns Buch wird dieser 'Kern' berührt und in einen geistes- und lebensgeschichtlichen Zusammenhang gestellt, den ich hier nur andeuten kann. Der Regress in die philosophische Intimität - die im 19. Jahrhundert angesichts von Positivismus und Zersplitterung in Einzelwissenschaften notwendig war, um Wahrnehmung, Verstand und Geist zu bewahren - ist heute verloren: Schlüpmanns Rettungsversuch besteht eben darin, dieses 'Verlorene' (über die "Theorie des Films" hinweg) in einer andern Art von Regress - in der "öffentlichen Intimität" des Kinos - wiederzufinden und zu behaupten. Was mir das Buch sofort sympathisch machte, war der Affekt gegen die Macht der Wissenschaft und ihren Anteil am "Grauen der Fortschrittsgeschichte". Der Film selbst hat ja auch wissenschaftliche Ursprünge, aber, sagt Schlüpmann, "das Kino entsteht aus der Entfernung des Films von den Wissenschaften." (S. 84) Für sie rettet das Kino - d.h. das Dunkel, in der die Projektion geschieht - das Affektive - also genau das, was von der wissenschaftlichen Haltung ausgeschlossen oder 'neutralisiert' wird. "... die Einheit des Subjekts des Wissenschaftlers ist durch die Affektion, die die aufgenommene Wirklichkeit in der Projektion hervorruft, bedroht." (S. 81) Das gilt ebenso für eine philosophische und theoretische Haltung, die mit dem Kino auch die Wirklichkeit von sich fernhält, sich im Gehäuse einer abstrakten, körperlosen Begrifflichkeit einsperrt und verliert. "Die Theorie mag ja mit dem Wissen um den Tod zu tun haben. Aber vielleicht doch so, dass es auf halbem Wege stehen bleibt, nicht einverleibt wird. Die Sterblichkeit denkt und fühlt dann nicht mit. Sie wird nicht zu einem Moment unserer Wahrnehmung der Welt. In die Welt wie ins Kino gehen: in das Dunkel der Vergänglichkeit. Das uns erwischt im Weinen. Die dumme Theorie, dumm aus Überheblichkeit, die der Angst entstammt. Weisheit, in der wir uns der körperlichen Reaktionen, des Lachens, des Weinens entheben, die allein uns doch retten." (S. 125) Wie ein roter Faden zieht sich dann ein Begriff durch das Buch, der auch auf einer 'Rückführung' beruht: es geht nicht um die Theorie, sondern um die Theoria - um das Schauen und die Schau im antiken Sinn. Davon hat ebenfalls der schweizer Schriftsteller Ludwig Hohl etwas gewusst, wenn er in 'Bild', dem zwölften Teil seiner "Notizen", schreibt: "Schauen ist tatsächlich alles, Wissen geht immer fehl (das heißt das Wissen, das dauern will; das höchste Wissen kann nur einen Moment bestehen, eben den Moment, da es entsteht, im Schauen enthalten ist)." Dieses Schauen meint also eine Bewegung, die nicht nur in einem rein äußerlichen (akkumulierenden) Sehen aufgeht, sondern sinnvolle und sinnhafte Verbindung von innen und außen ist - auch innere Schau sein kann. Auf die Kinematographie bezogen - das Licht der Projektion, das Dunkel des Kinos - ist dann im Hinblick auf das Aufgenommene und Wiedergegebene sinnvoll, von "einer immensen Dunkelzone der Wirklichkeit" zu reden. Das, was der Filmemacher in seinen Film aufnimmt, "führt .... einen Bruch in der Wirklichkeit herbei" - die Wirklichkeit des Films und die filmische Wirklichkeit ist "Fragment durch und durch" (S. 116). "Der Film, wie sehr er äußere Wirklichkeit aufnimmt, hat seine Bedeutung für das Leben der Menschheit darin, dass dieses Aufgenommene auf die Wirklichkeit im Dunklen, die sich nicht aufnehmen lässt, verweist." (S. 117) Interessant ist auch das Schlusskapitel, 'Kinematographie in der Wissenschaftsinstitution', dem nicht umsonst dieses Motto vorangestellt ist: "Kinema, griech.: Bewegung, Erschütterung; übertr.: innere Aufregung, Aufruhr." Eine Setzung, die auch eine Entgegensetzung ist. Es werden Weichenstellungen beschrieben: die Humboldtsche Universität, die das 20. Jahrhundert überdauerte, hat unter dem Signum der bürgerlichen Kultur die Auswirkungen der Massenkultur abgewehrt. ("Das Kino markiert wie kein anderes Kulturphänomen den Anfang der Massenkultur." S. 143) Dazu hat auch die Kritische Theorie nach ihrer Rückkehr aus dem Exil beigetragen: Ihre Abwehr galt jedoch mehr der "kulturindustriellen Entmündigung", also "einer in Kulturindustrie umgeschlagenen Massenkultur". (S. 145) Die heutige Verabschiedung der Humboldtschen Universität (und damit der Einheit von Forschung und Lehre) geschieht nicht im Kontext der Massenkultur (obwohl es ja die 'Massenuni' gibt), sondern eher kulturindustriell - die 'Medienwissenschaft' hat die zarten Versuche einer Filmlehre und -forschung schnell überholt. "Seit längerem schon hat sich die Wissenschaft aus dem Verbund von Forschung und Lehre herausgelöst, wird als Erwerb und Anhäufung von Wissen verstanden und als oberstes Gebot jenen vorangesetzt. In dieser Dynamik bildet Wissenschaft jedoch eine Einheit mit dem Erwerb und der Akkumulation von Kapital, bevor sie überhaupt offiziell auf die Wirtschaft eingeschworen wird. Dieser Einheit sehen sich heute die Lehrenden und Studierenden subsumiert." (S. 145/6) Kracauer selbst wird "errettet", weil er an einem "Naturrest" festgehalten hat - mit seiner Außenseiterposition Obdach im Kino fand. Dieser "Naturrest" wird bei Schlüpmann, wenn ich recht verstanden habe, dem "Nicht-Menschlichen" zugeschlagen (was gewiss etwas anderes ist als das Un-Menschliche, das ja sehr viel mit geistiger Vermessenheit zu tun hat). Ich würde an dieser Stelle (mit dem schweizer Philosophen Hans F. Geyer) lieber die Kategorien "Geschichtsnatur des Menschen" und "Naturgeschichte" einsetzen - auf letzterer, die sehr viel langsamer vor sich geht, gipfelt sich der menschliche Geist so auf, dass der Rückbezug (der schon physiologisch, über den eigenen Körper gegeben ist) in Vergessenheit gerät oder negiert wird. Vor allem im hinteren Teil des Buches gibt es einige Begriffs-Oppositionen (oder Komplementaritäten), die, glaube ich, Sinn machen. Schlüpmann insistiert auf dem 'alten Affekt' der Liebe zur Wahrnehmung und zum Wahrgenommenen (den noch Adorno pflegte) - aber es gibt für sie, "jenseits des Spiegels und der Spiegelungen", auch das Nicht-zu-Liebende am Kino. Dieses hervorzutreiben habe die Avantgarde als ihre Aufgabe angenommen - und darin habe sie einen (verstellten) Bezug zum frühen Kino. Es gebe da eine Leerstelle, die produktiv zu machen sei, ein utopisches Potential, das nur über die Kultur der Massen (die Vorstellung des Publikums von einem menschlichen Leben) zu aktivieren sei - und diese Leerstelle müsse offengehalten werden, dürfe nicht überspielt werden durch spektakulären Einsatz von Technik. (Von daher komme Kracauers Misstrauen gegenüber der 'Formtendenz', schon bei Méliès.) "Wer zur Menschheit dazugehören will, muss sich an der Reproduktion westlicher Kulturgüter, an ihrer Mediatisierung, beteiligen. Dieser Tendenz entzieht sich ein Umgang mit dem Film, indem er weder Kulturgüter vermittelt noch selber eines wird, sondern sich in der Schaulust des Kinos der Theoria bewusst wird." (S. 154) "Das Kino hat die Vereinzelten, der Leere Ausgesetzten, noch einmal im Zeichen einer Liebe zur Wahrnehmung versammelt. Es tritt darin durchaus die Nachfolge der Philosophie an, einer entsublimierten Philosophie ...." (S. 158) "Erst wenn das Publikum sich eine andere Kultur vorstellen kann, gewinnt die Leerstelle für es Bedeutung. Um diese Vorstellung bilden zu können, setzen sie sich der Leere aus, verweilen sie bei ihr. Diese Bildung kommt aus den Kräften, die auch die Träume hervorbringen, sie kommt nicht aus dem Bewusstsein. Das frühe Kino hat ein starkes utopisches Potential ..." (S. 161) "Bei der Leere verweilen fordert wieder die Möglichkeiten heraus, die im Unbewussten liegen. Möglichkeiten, von deren Verwirklichung wir uns abgeschnitten fühlen ...." (S. 166) Man wird vielleicht bemerkt haben, wie schwierig es ist - über '68 hinaus -, an etwas festzuhalten, was noch Züge des Emanzipatorischen trägt. Die Hypostasierung des Kinos, die in Heide Schlüpmanns Texten evident ist, ist wohl eine Auswirkung dieser Schwierigkeit - andrerseits ist eine solche Vereinseitigung völlig gerechtfertigt, weil gerade so und nicht anders eine Wahrheit aufscheinen kann. (Die Hypostase selbst - wie etwa auch bei der Musik - verweist ja darauf, dass an etwas Rettendem, Dahinter-, Darunterliegendem, festgehalten werden soll.) Wirklicher Progress kann sich heute, scheint mir, nur noch in einem Rückgriff äußern auf ein Davor - als Hinwendung zu dem Punkt oder Ort, wo noch etwas anderes möglich war und dann verstellt worden ist. (Allerdings könnte man ja sagen, das utopische Potential des frühen Films, von dem Schlüpmann spricht, sei ausgeschöpft worden - als eine Möglichkeit, die eben auch drin lag.) Es gibt jedoch, wie Bernd Nitzschke sagt, nicht nur die pathologische Regression, sondern auch die schöpferische - in Frankreich etwa hat der 'unterirdische' Bezug auf Charles Péguy (der im 1. Weltkrieg gefallen ist) Kräfte des Beharrens und Ausharrens freigesetzt, die weiterwirken. (Durch Huillet & Straub zum Beispiel, auch durch Rivette u.a.) Die Frage ist also, auf wie 'verlorenem Posten' der Regress steht - ob noch etwas auszurichten ist damit. Ob er nicht - in der Vergegenwärtigung, Sondierung dessen, was ist - notwendigerweise in die 'leibliche Geste' eingeht, also ganz einfach lebensnotwendig ist. pburg, 25. März 2006 um 17:47:49 MEZ ... Link Samstag, 7. Januar 2006
Zwangsverhalten: Zu Hong Sang-soos "Tale of Cinema" (Südkorea 2005) Hong Sang-soos Filme sind flach. An der Oberfläche: Licht, Bildaufbau, Stellung der Figuren im Raum. Und in ihrer Tiefe, denn kaum glaubt man, hineingelangt zu sein, rutscht man ab und steht wieder da, wo man war: vor einer Oberfläche, an der sich Gedanken und Geschichten zu Rätselkristallen formen, die fremd bleiben. Man wird nicht recht schlau aus alledem und treffender lässt es sich nicht ausdrücken als Hong es seinen Ich-Erzähler ganz am Ende von "Tale of Cinema" sagen lässt: "Ich muss denken". Hongs Filme zwingen einen allerdings, da muss man genau sein, weniger dazu zu denken, als sie einen in diesen Gedanken hineindrängen, dieses "Ich muss denken", das nirgendwohin führt, jedenfalls nicht in eine Tiefe, die dann erklärte oder plausibel machte, was man an der Oberfläche sieht. Die Rätselkristalle sind stets mehr Kristall als Rätsel, sie weisen den Blick ab, der sie umfassen möchte, sie erschließen sich nicht einer Lösung, aber sie haben eine merkwürdige Attraktivität, die Attraktivität des Sich-Entziehenden, die mit der Anziehungskraft der Figuren rein gar nichts zu tun hat. Denn unerträglichere Protagonisten gibt es kaum im Kino der Gegenwart als die männlichen Helden bei Hong mit ihrer latenten Aggressivität, der Kleinlichkeit ihres Scheiterns und der Unfähigkeit, in Frauen etwas anderes zu sehen als das, was sie projizieren. Genauer gesagt sehen sie noch nicht einmal ihre Projektionen: sie projizieren nur, aber ins Leere, sie bleiben im eigenen, unbegriffenen Narzissmus echolos befangen. Hong Sang-soo ist ein Strukturalist, aber kein Formalist. Das strukturelle Prinzip seiner Filme ist eine Streuung und Ausstreuung von Motiven, Spiegelungen und Wiederholungen in der Fläche. Man muss höllisch Acht geben aufs Detail, da Signale oft untermarkiert sind (wenn auch keineswegs immer); aber dass man sie erkennt, heißt nicht, dass man sie lesen kann. Sie entziehen sich vielmehr der Lesbarkeit ins Strukturelle. Und die Struktur selbst bleibt unlesbar, da sie nicht die Regularität einer Form gewinnt, sondern einer beliebigen Streuung gehorcht, eher dem Schein nach als prinzipiell geordnet durch die Zweiteilung und Spiegelung der Narration; was Grund-Struktur scheint, ist viel eher Form als trompe-l'oeil, ein Anhalt, der einem unter dem Denken zerfällt. Die Streuung der Motive auf der flachen Oberfläche führt so zur Flucht nicht des Gedankens, sondern des Denkens: "Ich muss denken", aber ich weiß nicht was. Es führt nirgendwohin, auf keinen Grund, immer nur weiter. Es ist schwer, einem, der sie nicht kennt, einen Eindruck von Hongs Filmen zu vermitteln. Eine (seltsame) Vertracktheit und eine (seltsame) Kunstlosigkeit gehen hier in eins. Die entschiedene Verneinung realistischer Konzepte wird konsequent unterspielt; man könnte auch Menschen sehen und nichts weiter, die an Tischen sitzen und sich betrinken, die auf Straßen spazieren und reden, die in Hotelzimmer gehen und miteinander schlafen. Und wenn Menschen sich umbringen wollen (wie im Film-im-Film in "Tale of Cinema") oder wenn sie im Sterben liegen (wie in der zweiten Hälfte der Regisseur des Films-im-Film in "Tale of Cinema"), dann ändert Hong kein bisschen seine lakonische Art, die Kamera in den Raum zu stellen und die Szene als Plansequenz zu drehen und sie, einfach so, nicht mittendrin, aber auch nicht in einem besonderen Moment, zu beenden, mit einem Schnitt, aus dem geschlossenen Raum hinaus auf die Straße, von der Straße hinein in den geschlossenen Raum. (Von den Zooms wird noch zu sprechen sein.) An den Dialogen, sagt Hong, feilt er lange, aber auch hier geht es nicht um Pointierungen, eher um die subtile Verankerung der latenten Aggressivität, die alles durchzieht, im Wort. Die Worte, die gewechselt werden, sind durchzogen wie die so lakonisch gebauten Bilder von dieser latenten Aggressivität. Dazu kommt eine große Armut der Motive, ein hoher Grad an Repetition. Es wäre nicht ganz verkehrt, auf dieser abstrakten Ebene eine Analogie zu den Filmen Ozus zu sehen, die sich freilich völlig anders anfühlen, die völlig anders gearbeitet sind. Aber sie sind ähnlich verschlossen und ähnlich oberflächlich. Bei Ozu geht es um Väter (und Mütter) und Töchter (und Söhne), um das Unglück, das darin besteht, dass sie sich trennen müssen – auch wenn sie nicht wollen, dass das Sich-Nicht-Trennen-Wollen keine Option ist -, dass die Töchter (oder Söhne) aus dem Haus gehen und dass daraus folgt – und das ist die eigentliche Tragödie -, dass die Eltern alleine zurück bleiben im Haus. In Hongs Filmen gibt es kein Zuhause, auch keinen Wunsch, in ein Zuhause zurückzukehren und die Familie im Film-im-Film in "Tale of Cinema" ist schlicht und einfach grotesk (aber ihr Auftreten allein macht die Frage schon virulent, ob der Film-im-Film ein Hong-Film ist). Bei Hong geht es um Männer, die als Künstler scheitern und gegen die Frauen, die sie lieben wollen, sich aggressiv verhalten. Männer, denen die Schließung ihrer Projektion nicht recht gelingt. Sie bewegen sich, ungelenk, aber stürmisch meist, hinein in die Projektion, sie wollen ein Werk, sie wollen eine Frau, aber sie bleiben stecken, sie tun das Falsche und dass sie sich betrinken und als Betrunkene noch unerträglicher werden, ist nicht die Ursache, sondern nur der Ausdruck dieses Unglücks. Die jämmerlichen Männer bei Hong wissen, dass sie wollen, aber wenn sie diesem Wollen erst einmal Ausdruck gegeben haben, merken sie (oder spüren sie), dass sie nicht wissen, was sie wollen. Dann zaudern sie, dann können sie nicht, dann verdrücken sie sich. Es ist im Grunde derselbe Impetus, der hinter dem "Ich muss denken" und dem "Ich muss wollen" steht. Der doppelte Impetus macht diese Männer zu Möchtegern-Künstlern und Möchtegern-Liebenden. Aber dann wollen sie nicht, dann denken sie nicht, weil ihre Fähigkeit, einen Gegenstand (ein Werk, eine Frau) zu wollen und zu denken, nicht hinreicht. Es ist nicht so sehr der Fall, dass sie zu intellektuell wären, dass ihrem Handeln das Denken als Skepsis oder handlungshemmende Reflexion in die Quere kämen. Vielmehr ist jedes mögliche Denken von etwas, jedes mögliche Wollen, das über das schiere, leere Begehren hinausgeht, immer schon blockiert. (Das Ende von "Tale of Cinema" ist deshalb als totale Kapitulation zu begreifen, als ein Verharren im Elend. Das Wollen des Denkens führt nur in die Wiederholung des Missglückens.) Auf den ersten Blick passt "Tale of Cinema" in die Serie der bisherigen Filme. Das gewohnte Spiel mit den vermeintlich glatten Gang der Narration zerreißenden Irritationen findet statt. Das Theaterstück, das man (im Film-im-Film) sieht, bekommt einen anderen Sinn als den diegetischen (der Held wartet, bevor er sich mit der Frau trifft, auf die er sein Lieben-Wollen gerichtet hat) in dem Moment, in dem der Held die Worte einer der Figuren wiederholt: Mutter, Mutter. Es wird hier der Eintrag einer kleinen, aber massiven Irritation erst verständlich: Auf der Bühne spricht die Figur der Mutter nämlich von ihrem Sohn, obwohl es sich offensichtlich um ihre Tochter handelt. Vorträglich – und mit Mut zum Unverständlichen - hat Hong den Konflikt des Sohnes mit der Mutter schon eingetragen. Zwischen unverständlichem/unauffälligem Vortrag und sinnveränderndem Nachtrag inszeniert Hong sein Spiel um Aufschübe und Suspensionen. Die Momente, in denen Irritationen als Wiederholungen miteinander und aufeinander reagieren, haben freilich nichts Erlösendes und Lösendes. Sie bleiben mehr oder minder blinder Verweis, der auf weitere Nachträge wartet, die wiederum nichts lösen, selbst da, wo sie nicht ausbleiben. Und wie oft bei Hong findet sich auch in "Tale of Cinema" die Installation einer Zäsur, die solche Spiegelungen und Verdopplungen nachdrücklich hervortreibt. Wieder finden sich Gegenstände, Orte, Personen des ersten Teils im zweiten aufgegriffen, gelegentlich mit genau dem Willen zur Untermarkierung, der das bisherige Werk prägt. Diesmal aber ist bei genauerer Betrachtung alles ganz anders. Zu tun hat es mit Markierungen. Erstmals nämlich markiert Hong den Repetitionsscharakter, thematisiert ihn als Verhältnis von Kino und Leben und Kino. Der Film, den wir sehen, vierzig Minuten lang, ohne zu wissen, dass es (im Film) nur ein Film ist, wird als die gestohlene Geschichte des Mannes präsentiert - nachträglich, mit einer Nachträglichkeit, die alles (womöglich) in ein anderes Licht stellt. Vor allem aber setzt sie die Wiederholung ausdrücklich, wenngleich sanft ironisch, unters Vorzeichen eines thematisierten Wiederholungszwangs. Die typische Bewegung beim Sehen eines Hong-Films – man liest, irritiert durch ein Detail, eine Wiederaufnahme, eine Wiederholung, den Film neu; man liest bestimmte Stellen, die man zuvor gesehen hat, anders, nämlich als Antizipationen der Wiederholung -, diese typische Bewegung wird hier aktiv ausgestellt, etwa im Fetisch-Gegenstand "Marlboro Reds", den Zigaretten, die im Film-im-Film der Held in einem Laden kaufen will, die im Film dem Helden, der sie raucht, als Beleg dafür dienen, dass der Regisseur seine Geschichte gestohlen hat. Fetischisiert werden diese Gegenstände nicht im üblichen Sinne. Nicht sie selbst werden mit Begehren aufgeladen, sondern ein ungezieltes Begehren, das zwischen der Vor- und Nachträglichkeit ihres Auftauchens oszilliert, macht sich für den Moment fest am nichtsdestoweniger beliebigen Gegenstand. Das Problem der Verschiebung und Lösung des Begehrens vom eigentlichen Gegenstand, die Aufladung eines anderen an seiner Stelle, ist nicht die Struktur des Problems der Hongschen Helden. Sie sind zur Liebe (zum Wollen und Begehren von etwas, einem Begehren, das über das bloße Wollen und Begehren hinausgeht), und damit eben auch zur verschobenen Bewegung der Aufladung unfähig. Nun aber die Zooms. Mit "Tale of Cinema" bricht Hong den seriellen Charakter seines Werks – oder vielmehr lässt er ins stete Sich-Wiederholen des Vertrauten ein fremdes Element einbrechen. (Vielleicht nicht ganz unähnlich der Art, wie Tsai Ming-liang in seinem letzten Film "The Wayward Cloud", Musicalbuntheit in seinen ganz anders gearteten Stil einbrechen lässt.) Die unauffällige Plansequenz mit tendenziell statischer Kamera wird völlig unerwartet irritiert durch Zooms, die durch den Raum fuhrwerken, ihn beschneiden, Gesichter aus ihrem Zusammenhang nehmen, um sie dann, im Rückzoom, wieder in einen (damit aber anderen, aufgebrochenen) Raum-Bild-Zusammenhang zurückzuführen. Die Zooms sind, wie die Markierung der Wiederholungen als Wiederholungszwang, ein Ausbruch aus der Unauffälligkeit, der (seltsamen) Kunstlosigkeit von Hongs Kino. Sie scheinen, um das mindeste zu sagen, nicht notwendig, fungieren als Irritationen, sie fügen sich nicht zwanglos ein in den Stil, der vorherrscht. Sie sind nicht elegant, oft eher ungelenk – und sie sind das ohne Zweifel mit Absicht. Sie sind Unterstreichungen in einem Stil, der bisher – und im Grunde noch immer – vom oft schockierenden Weglassen von Unterstreichungsgesten lebt, etwa im beinahe unvermerkten Übergang vom Film-im-Film zum eigentlichen Film. (Klar erkennbar nur im Wechsel der Musik von der Seite der Non-Diegese auf die Seite der Diegese.) Die Zooms sind aber Unterstreichungen, bei denen unklar bleibt, warum sie unterstreichen, was sie unterstreichen. Den Gesichtern, auf die gezoomt wird, ist wenig Expressives abzulesen. Über die Figuren im Raum erhält man kaum zusätzliche Informationen. Die fortwährende Zeigegeste des Zooms zeigt ins Leere wie das Wollen und Denken der Figuren. Dem "Ich muss wollen" und dem "Ich muss denken" gesellt sich ein "Ich muss zoomen". Ein Zwangsverhalten im Grunde. Damit wäre "Tale of Cinema" der pathologischste von Hongs Filmen. Die vermeintlichen Symmetrien, die sich der Mittelzäsur verdankten, waren bisher durchaus als Eindringen eines Wiederholungszwangs in die Struktur lesbar (und eher noch fühlbar) – aber doch ins trompe-l'oeil, den Schein einer Form hineingebändigt. Der Zoom (und ähnlich der Voiceover-Kommentar) in "Tale of Cinema" sind von in keine Form mehr zu bändigender Zwanghaftigkeit. Sie führen nirgendwohin, sie sind (falsche) Bewegung um der Bewegung willen. Was in ihnen sich Bahn zu brechen scheint, ist die Attacke auf die eigene Kunst, eine mutwillige Beschädigung der Bilder, als wären sie noch immer zu schön gewesen. Diese Zooms sind nicht der Versuch einer Rehabilitation des Zoomens; sie sind absichtliche Zerstörung von Unauffälligkeit. Bisher handelte Hongs Kino in zum Schein wenigstens "schöner", symmetrischer, reizvoller Form von beschädigten Menschen. Mit "Tale of Cinema" ist es nun zum beschädigten Kino geworden, hat jener autoagressive Narzissmus auch strukturell die Überhand gewonnen, der bislang vor allem seine männlichen Helden befiel. knoerer, 7. Januar 2006 um 11:26:46 MEZ ... Link Mittwoch, 5. Oktober 2005
Pop-Star mit Brille von Harun Farocki Ich sah Fassbinder, zunächst als Darsteller, das erste Mal 1969, auf einem Festival. Damals musste ich nicht einmal den Tod fürchten, die Welt würde sich bald so ändern, dass mir ein weiteres Leben bevorstand. Was ich jetzt lebte, war nur ein Vorleben, so wie die Kindheit nur eines gewesen war. Bei einer Versammlung der Eltern des Kindergartens, in den wir unsere Kinder schickten, sagte ein Vater-Genosse, eine gewisse Ordnungsfunktion der Polizei müsse man doch anerkennen; dass sie etwa die Kinder über die Strasse brächte, man müsse notwendige Ordnung und Unterdrückung auseinander halten. Während Godard nach den Erschütterungen von 1968 nie wieder zu den Filmen zurückkehrte, die er, mit recht viel Erfolg, zuvor gemacht hatte, glich Fassbinder bald seine Filme dem an, was jedermann so unter einem Film versteht. Er gab die Plansequenzen auf und machte die Interaktion der Darsteller wieder zur Hauptsache. Die Kamera sah sich nicht auf dem Schauplatz selbstständig um, sie nahm bloss aus ein paar Richtungen das Spiel der Akteure auf, um das Material für eine Montage zu erzeugen, für die Akzentuierung des Darsteller-Spiels mit Schnitten. Auch Wenders enttäuschte, weil er bei seinem ersten grossen Film ("Die Angst des Torwarts beim Elfmeter") mit Schuss und Gegenschuss erzählte. Das war für mich ein Verrat an der Revolution. Da zeigte sich, dass die Menschen sich nicht darauf verlassen wollten, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, sie gaben der – in Gedanken – schon demobilisierten Polizei die Uniform und die Waffen zurück. Bald würde es auch wieder eine Armee geben, mit einem etwas anderen Namen als zuvor. Wenn ich einem politischen Freund oder Genossen zu erklären versuchte, dass es einen Zusammenhang von Filmform und Politik gab, kam ich damit nicht weit. Wie ein Film erzählte, mit was für Einstellungen, das war keinem wichtig, während doch bei der Musik der Sound so viel, oder alles, bedeutete. Viele, die an Adorno ihr Sprachvermögen geschult hatten, arbeiteten sich den Tag über mit Worten ab und benutzten am Abend das Kino, das Fernsehen, als Erholungsstätte. So wie die Fabrikarbeiter von ihrem Arbeitstag so erschöpft sind, dass sie am Abend nur noch Schund aufnehmen können sollen, waren sie vom politischen Denken und Sprechen – "Anstrengung des Begriffs" – so erschöpft, dass sie nur noch einen Italo-Western sehen konnten – "Ermattung des Bildes". Sie kamen gar nicht dazu, mich zu fragen, wie es denn mit Schuss und Gegenschuss bei den amerikanischen Regisseuren stand, die ich hochhielt. Ich hätte antworten können: Godard wie Straub beriefen sich auf Hawks oder Ford, machten aber Filme, die auf den ersten Blick damit kaum etwas zu tun hatten. Es ging um eine Essenz, nicht um die Syntax. Ich hatte von den Nouvelle-Vague-Autoren die kanonische Namensliste übernommen, auch ich versuchte, beim Anschauen etwas ganz anderes aus den Amerikanern zu machen. Ich sah so sehr von deren manifester Mitteilung ab, dass ich die Worte, die gesagt wurden, gänzlich überhörte und nicht auf den Ausdruck der Darsteller sah, eher auf den Raum zwischen den Filmfiguren. Für Fassbinder nahm mich zunächst ein, dass er die Straubs in sein Theater eingeladen hatte und in dem Stück, das sie dort inszenierten und in ihren Film aufnahmen, mitspielen liessen. In "Liebe ist kälter als der Tod" zitierte er eine Sequenz aus "Der Bräutigam, der Komödiant und der Zuhälter" der Straubs, ein wunderbares langes Travelling über eine Strasse mit Prostituierten, die aber nicht ausgestellt werden, in der Mitte der Einstellung setzt Bach-Musik ein. Das ist ein starker Effekt. Auch Pasolini hatte schon Bach-Musik eingesetzt um eine Verbindung zwischen den ausgebeuteten Menschen heute und dem Jesusleiden herzustellen, auch er hatte die Musik mitten in der Szene beginnen lassen, sodass die Willkürlichkeit der Montage zu empfinden war. Bei den Straubs kam noch hinzu, dass der Film auf einer Bühne mit Darstellern beginnt, dann das Register wechselt und auf eine wirkliche Strasse ohne Darsteller springt. Und mit dieser Parallel-Verschiebung ist der Zusammenhang von Ausgebeuteten und Gottessohn deutlich Konstruktion, eine geometrische Übung, die auf Wahrheit und Schönheit in einem aus ist. In "Katzelmacher" gab es ein paar der Darsteller zu sehen, die in "Der Bräutigam…" gespielt hatten, und es gab ein Godard-Zitat. Eine Frau gibt einer anderen einen Stapel mit Groschenheftchen zurück und liest eine besonders schöne Stelle vor. Die gleich Stelle, die in "Vivre sa vie" eine Kollegin von Nana im Schallplattenladen vorliest: "Sein Blick war auf den türkisenen, mit Sternen übersäten Himmel gerichtet, als er sich mir zuwandte. ‚Alles an Ihnen verrät ein intensives Leben. Logischerweise müssten Sie…‘ Ich unterbrach ihn: ‚Sie messen der Logik viel zu viel Wichtigkeit und Einfluss zu.‘" "Katzelmacher" besteht nur aus Plansequenzen. Keine einzige Grossaufnahme, keine einzige Totale. Die Kamera bewegt sich nicht, mit einer Ausnahme. Ein halbes Dutzend mal gehen je zwei Personen über einen breiten Hof, die Kamera fährt dabei vor ihnen her, eine Klaviermusik ist bei diesen Travellings zu hören, die einzige Musik im Film. Diese Travellings enden so abrupt, dass manchmal der letzteTon nicht ausklingen kann. Diese Fahrten sind eine Art Refrain und sie machen vor allem deutlich, dass es auch in den Strophen keine wirkliche Bewegung gibt. Ich glaube, diese Erzählfigur, ein solches formalisiertes Travelling immer wieder, hat es im Kino noch nie gegeben. Immerfort scheint die Sonne, als wäre der Film an einem einzigen schönen Tag gedreht. Männer und Frauen aus einer Nachbarschaft in München. Auf einem Hof versammeln sie sich, in wechselnder Besetzung stehen sie in einer Reihe an einem Geländer, das den Schacht zu einem Keller absperrt. Sie setzen sich auch auf das Geländer oder auf dessen Fundament. Sie nutzen anscheinend jede Gelegenheit, dort abzuhängen, wie Jugendliche, die nicht mit den Eltern in der Wohnung sein wollen. In den Wohnungen aber leben sie allein oder zu Paaren, ohne Eltern und ohne Kinder. Sie sind auch zusammen in der Gastwirtschaft, auch da in wechselnder Besetzung. Bei jedem Zusammensein sagt ein jeder kurze Sätze in einem Kunstbayrisch, wobei eigentümliche Wendungen, so die doppelte Negation, ausgestellt werden. Sie besprechen kaum etwas Faktisches, selbst das Faktische klingt bei ihnen wie eine Sentenz. Sie sprechen ständig kleine Lebensweisheiten aus. Die Männer sind hauptsächlich stumpf und haben einen Zug zum Kleingangster oder Zuhälter. Die Frauen sind auf das Schönsein und auf die Männer aus, sie tragen sehr kurze Mini-Röcke. Eine Frau hat etwas Vermögen und hält sich für etwas Besseres. Alle Schauplätze sind spärlich dekoriert, an den weissen Wänden ist meistens nichts. Die Kamera steht immer im rechten Winkel zur Rückwand, so wie es das in der frühen Kinematographie gab. Auch wenn eine Szene einmal in einem Auto spielt, bewegt sich dieses nicht ein Stück, das sieht noch künstlicher aus als ein Sessel oder Gastwirtschaftstisch, aufgenommen im rechten Winkel vor der Rückwand. Katzelmacher, von Fassbinder gespielt, ist ein Gastarbeiter aus Griechenland – die Deutschen sagen "Fremdarbeiter", wie im Krieg, und halten ihn lange für einen Italiener. Sie reden schlecht von ihm und sind sich darin einig, ohne dass damit die Gehässigkeiten unter ihnen aufhörten. Sie reden schlecht über ihn auch wenn sie ihn zu einem Bier einladen, was er nicht versteht oder verstehen will. Als seine Zimmervermieterin mit ihrem Mann und dem "Griech aus Griechenland" in die Gaststätte kommt, werden die drei von der Gruppe wieder vertrieben. Und als Katzelmacher einmal über den Hof geht und dort nur Männer stehen, fallen sie über ihn her und verprügeln ihn. Das bringt ihn nicht dazu, fortzuziehen. Und auch seine Wirtin schmeisst ihn nicht raus, weil sie ihm für ein Zimmer – dass er mit dem Ehemann teilen muss – 150 Mark zahlt. Das gibt den Ausschlag. Dass man den ausländischen Arbeitern soviel Geld abnehmen kann belegt, dass sie für die "Deutsche Wirtschaft" von Nutzen sind. Der Katzelmacher hat auch eine Liebschaft mit der Frau, die von Hanna Schygulla gespielt wird. Einmal sitzen sie zusammen auf einer Bank, und das sieht aus wie bei Stroheim. Das Sonnenlicht macht aus den Stadtpark-Bäumen einen Zauberwald. "Katzelmacher" ist schon deshalb politischer als die meisten Filme dieser Zeit, weil er von Vielen ausgeht und nicht von einer Person oder einem Paar. Die ganze Nachbarschaft steht in Zusammenhang und die Liebe zum Gastarbeiter ist deshalb vom Gastarbeiter-Verprügeln nicht zu trennen. "Warum läuft Herr R. Amok?" sah ich damals im Fernsehen, in schwarz-weiss, weil wir noch keinen Farbfernseher hatten. Auch die Filme von Rohmer kannte ich nur von der schwarz-weissen Fernsehwiedergabe, so waren die Gegenstände und Menschen stärker konturiert und ein Blick in die Bäume (in "La Collectionneuse") sah so zweckdienlich aus wie die Grossaufnahme eines Revolvers im Gangsterfilm. Herr R. ist ein angepasster Mensch, zu Beginn des Films kommt er mit seinen Arbeitskollegen aus der Hintertür eines Häuserblocks in München, die Handkamera geht ihnen voraus. Die Kollegen erzählen Witze und R. schweigt dazu. Als sie um die Ecke des Hauses biegen, kommt ein Auto in den Hofweg gefahren, setzt wieder zurück. In diesem Augenblick wird deutlich, dass das Auto nicht zur Inszenierung gehörte und nur zufällig in die Einfahrt einbog, um zu wenden. Eine Einstellung, für die man nicht bezahlt, die man nicht offiziell macht, mit Polizei-Genehmigung und Absperrung, nennt man in der Branche eine "gestohlene Einstellung". Alle Einstellungen in diesem Film über Herrn R. sehen gestohlen aus. Der Film behauptet, von ganz alltäglichen Menschen in gänzlich alltäglichen Situationen zu handeln. Aber R. und die Menschen um ihn, Familie, Freunde, Kollegen, sehen aus, als hätten sie sich ins Bild geschlichen. Fahren sie mit dem Auto, so ist zu erwarten, dass die Polizei den Wagen gleich anhält, und sitzen sie in der Gastwirtschaft, muss eigentlich die Wirtin gleich kommen und sie rausschmeissen. Der Film will erzählen, behauptet zu erzählen, welchem Anpassungsdruck der Alltagsmensch in der Bundesrepublik unterworfen ist. Davon ist nichts zu glauben. Der Hauptdarsteller Kurt Raab sieht verkleidet aus, hat einen Anzug an wie zur Konfirmation und hat eine Frisur als habe ihm die Mutter die Haare gekämmt. Die Darsteller haben deutlich keine Erfahrung mit dem Erwachsenen-Leben, das sie da spielen und anklagen. Eine Sequenz, die mir damals sehr gefiel, spielt am Arbeitsplatz von R., die Kamera schweift von ihm ab zu seinen Kollegen. Eine Frau schreibt auf der Maschine, ihr Klappern begleitet die ganze Szene, in der nicht gesprochen wird. Ein Bauzeichner ist zu sehen, der mit äußerster Akribie seine Zeichengeräte einrichtet und dann ein paar Bäume neben ein Gebäude setzt. Es geht um die Darstellung eines großen Wohnblocks und sicher soll auch dargestellt sein, dass die Sklavenarbeit des Zeichnens sich in der Sklavenexistenz in solchen Wohnblocks fortsetzt. Der Ordnungswahn regelt das Leben. Das Leben auf den rechteckigen Grundflächen kann nur ein überreglementiertes und überall gleiches sein – allerdings fasst auch eine Filmkamera jedes denk- oder erträumbares Bild in den gleichen rechteckigen Rahmen. Gegen die falsche Ordentlichkeit rebelliert der Film, indem er mit der Handkamera in Plansequenzen umherschweift und dabei vorgibt, er habe kein bestimmtest Ziel. Eigentlich ist jede Szene in diesem Film durchaus geeignet, zu einem Bild von R. und seiner Umgebung beizutragen, bei der Umsetzung aber schämt sich der Film zu sagen, was er sich zu sagen aufgetragen hat. Er fängt etwas an und nimmt es zurück. Ich glaubte damals daran, dass alles ganz anders werden müsse, wenigstens im Film. Es gab zu Beginn der siebziger Jahre durchaus schon Filme, die versuchten, politische Positionen in die Alltagssprache des Kinos einzuführen. Von Entristen also, die ihre Filmpersonen etwas Fortschrittliches tun oder sagen ließen, während der Film so aussah wie jeder andere. Stand ich an einem Morgen mit Flugblättern vor einem Fabriktor, meistens einem der Berliner Elektrowerke, nahm kaum eine der Frauen ein Blatt auch nur an. So erfuhren wir nicht, ob die Frauen – die meisten ungelernten und angelernten Arbeitskräfte waren weiblich – mit einem Wort wie "Entfremdung", "Entsublimierung", "tendenzieller Fall der Profitrate" nichts anfangen konnten oder nicht wollten. Also wurden die Flugblätter umgeschrieben, in die vermeintliche Alltagserfahrung der Fabrik-Arbeiterinnen übersetzt. Und wie diese Umschreibungen kamen mir auch die neuen politischen Filme vor. Wie die Beispiele, die der Lehrer in der Schule gibt: eingekleidete Rechenaufgaben. Die Filmpersonen redeten und handelten, damit der Lehrstoff nicht trocken blieb. Eine klassenkämpferische oder feministische Haltung schrieb man den Filmpersonen natürlich auch in den Mund, damit sie wenigstens im Film so sprachen, wie wir uns das fürs Leben wünschten. Der Film über Herrn R. musste mir schon deshalb damals gefallen, weil Fassbinder die Versöhnung von herkömmlichem Film und neuer Politik nicht erpressen wollte. Mit seiner Fernsehserie, "Acht Stunden sind kein Tag" ist er dieser falschen Versöhnung nahe gekommen. In dieser Serie soll ständig der Beweis geführt werden, dass Arbeiter oder Hausfrauen auch Film- oder Fernsehhelden sein können. Wenn sie auf ihren Rechten bestehen und fortschrittlich sprechen, tun sie das in der gleichen Weise, in der die Figuren in "Katzelmacher" ihre Ressentiments vortragen. Ihre Ansichten sind eingefleischt. Wenn Fassbinder bei den Szenen in der Fabrik die sprechenden Arbeiter mit Reiss-Schwenks verband, kam mir das nicht nur hässlich vor. Es kam mir vor wie eine offensiv gemachte Hilflosigkeit. Die Arbeiter riefen sich von Maschine zu Maschine etwas zu, wie man das in der Gastwirtschaft von Tisch zu Tisch tut. Die Maschinen wurden damit Gasthaustischen gleichgesetzt und es blieb aus dem Spiel, dass die Maschinen selbst die Arbeiter zu einander in Beziehung setzen. Jedenfalls die einzelnen so von einander trennt, dass Dialogworte diese Kluft nicht einfach überbrücken können. Standen wir mit Flugblättern vor einer Fabrik, so wollten die Arbeiterinnen kein Blatt von uns haben, die Frauen aus den Büros aber gaben uns einen interessierten Blick. Mit unseren manifesten Botschaften drangen wir nicht durch, eher mit der Geste unseres Tuns. Wir scheiterten politisch und hatten kulturell Erfolg. Fassbinder beteiligte sich nie an der Werbung für einen neuen Lebensstil. Sein Erfolg aber trug zu unserem, zweifelhaftem, bei. Fassbinder hatte mit allem, was er tat, Erfolg. Selbst eine Fernsehserie über Arbeiter, in der von der Kollektivität oder wenigstens Massenhaftigkeit der Arbeiter-Existenz nichts zu finden ist, wurde ihm als Erfolg gutgeschrieben. Die Intellektuellen in den USA begannen schon in den Siebzigern in Fassbinder den Autoren zu sehen, der die Gender-Fragen ansprach. In der Bundesrepublik war Fassbinder, zu Lebzeiten, etwas anderes. Die Bundesrepublik war nach dem Krieg schnell reich geworden und schämte sich etwas ihres neuen Reichtums. Nicht, weil es der Krieg gewesen war, der die industriellen Produktionsanlagen modernisiert und die Massenfertigung ermöglichte hatte. Das Sprechen vom Wirtschaftswunder war sich nicht bewusst, dass die industrielle Kapazität nach Kriegsende grösser gewesen war als vor dem Krieg. Scham wurde empfunden, weil man zwar Geld hatte, aber keine Lebensart. Das begann sich nach 1970 zu ändern, nun gab es Kleidung aus Deutschland, die sich exportieren liess, und aus der Scham wurde ein Triumphieren. Es war mir schwer erträglich, dass der "Junge Deutsche Film" in der Welt grosses Ansehen gewann und in der Bundesrepublik so getan wurde, als wäre er die Entsprechung zur Nouvelle Vague. Damit waren die Ansprüche der Nouvelle Vague zunichte gemacht. Als Fassbinders vorletzter Film, "Die Sehnsucht der Veronika Voss" im Fernsehen gezeigt wurde, war mir schon die erste Szene unerträglich. Im Kino wird ein UFA- Film aus der Nazi-Zeit gezeigt und Fassbinder sitzt im Zuschauerraum und sieht sich das mit grossem Interesse, mit Bewunderung, an. Der Film ist in Schwarz-Weiss, die Titel und vor allem die Blenden sollen auf die fünfziger Jahre verweisen. Glücklicherweise spielt der Film sonst weniger auf das Kino der Fünfziger in der Bundesrepublik als auf das aus den USA an. Der Film soll in München spielen, aber es drehen sich so viele Ventilatoren als spielte die Geschichte in den Südstaaten. In den Fünfzigern waren die Südstaaten in der Bundesrepublik durch Tennessee Williams gegenwärtig. In seinen Stücken kamen Homosexualität, Impotenz, Frigidität vor, ohne dass diese Worte ausgesprochen wurden. Sexualität erschien in diesen Filmen wie ein entlegenes historisches Ereignis, wie die Königs-Kriege in den Shakespeare-Dramen. Die Grundidee zu "Veronika Voss" ist rasant. Eine Nervenärztin verschreibt ihren Patienten Drogen und lässt sich das teuer bezahlen. Sie presst ihre Kunden aus, sie müssen ihr alles Eigentum überschreiben und wenn sie nichts mehr haben, bleibt ihnen nur noch die Selbst-Tötung mittels Drogen, womit das Testament wirksam wird. Der Film erzählt als Nebenstrang wie ein altes jüdisches Ehepaar von der Ärztin um Antiquitäten und Haus gebracht wird und sich das Leben nimmt. Der Mann zeigt einmal die Tätowierung vor, er ist im Lager gewesen. In der Bundesrepublik werden die Juden enteignet wie vor der Deportation. Dahinter steckt keine staatliche Stelle, es gibt nur einen korrupten Beamten bei der Gesundheitsbehörde, der den Drogenhandel deckt. Es geht dem Film darum, dass man mit Drogen Träume verkauft. Der Drogenhandel gehört zur Traum-Fabrikation, wie das Kino. Die besitzgierige Ärztin, zu deren Entourage auch ein dicker GI gehört, der stets US-Schlager summt, wohnt in einer Wohnung aus reinem Weiss, das blendet wie der Schnee. Der Haushalt der Ärztin, ihr Küchen-Kabinett ist eine Verächtlichmachung der deutschen Kino-Industrie. Auch Veronika Voss ist süchtig – weil ihr Starruhm nicht anhält. Weil ihre grosse Zeit – die mit der der Nazis zusammenfiel – vorbei ist. Sie war am Handel mit der Droge Kino beteiligt und ist dabei selbst süchtig geworden. Sie stirbt daran. Das ist heroischer als Überleben und Geschäfte-Machen – so charakterisiert der Film die Kino-Industrie und die Bundesrepublik im Ganzen. Die Darstellerin der Veronika Voss, Rosl Zech, hat Szenen zu spielen, in denen sie taumelt, weil ihr die Droge fehlt, und sie verpatzt aus dem gleichen Grund eine Filmszene – aus Gnade hat man ihr einen Drehtag gegeben. Wenn sie das Drogenabhängigsein zu spielen hat, tut sie das mit Minen und Bewegungen, die zum Repertoire des hysterischen Stars gehören, zu dem sie sich stilisiert hat. Schlimmer ist, wenn die Männer um sie herum Betrunkene spielen. Um Rückblenden als solche zu kennzeichnen, wird ein Filter benutzt, der jedes Licht im Bild zu einem strahlenden Stern vergrössert – ein Effekt aus dem Revue-Film. Eine solche Kennzeichnung fehlt für die Droge – die Droge bleibt eine Leerstelle. Die Droge wird nicht ins Bild gesetzt, ansonsten ist der Film voller Effekte. Wenn der alternde UFA-Star zu Beginn des Films einen Sport-Reporter kennenlernt und beide zusammen eine Fahrt in der Strassenbahn unternehmen, gehen hinter den Fensterscheiben der Bahn ganze Wasserstürze nieder. Solche Übertreibungen sind damit begründet, dass der Fassbinder-Film auf das Kino der fünfziger Jahre anspielt, als das Erbe des UFA-Films noch lebendig war und es den Mut gab zu etwas grösserem als dem Leben. Fassbinder hat grosses Vergnügen daran, mit den Effekt-Maschinen des Kinos umzugehen und führt die Effekte eher vor, als dass er sich ihrer bedient. Wenn eine Strassenbahn, die zwischen den Bavaria-Studios und München verkehrt, in vielen Einstellungen geboten wird, in denen grosse Wasser an den Fenstern vorbeistürzen, ist das ein Beweis für die Tatsächlichkeit der Strassenbahn und ein Schein-Beweis für die Rekonstruktion der historischen Zeit, in der der Film spielt. Wenn der Erzählapparat so sehr über einen Schauplatz gebietet, muss er sich doch in diese Zeit gänzlich versetzt haben. So gelingt Fassbinder ein Sprung in die Vergangenheit ohne all zu viel Historisieren. Gerade indem er nicht behauptet, die Welt die er zeige, ginge neben dem gezeigten Ausschnitt ebenso weiter. Während die Bilder in vielen Fassbinder-Filmen wurschtig waren – sind sie hier sehr genau, und manche sind betörend schön. Viele sind der Konstruktion des Sets eingeschrieben. Selbst wenn einiges an der Virtuosität angeberisch ist, ist das eine sympathische Angeberei. Vielleicht, weil Fassbinder das alles nicht so wichtig war, weil es ihm eigentlich nur auf ein paar Blick-Beziehungen ankam. Nach seinen ersten Filmen gab Fassbinder die Plan-Sequenzen auf suchte nach Gelegenheiten, das Anschauen oder Angeschaut-Werden in Szene zu setzen. Nach Augenblicken, in denen der Blick den Worten eigentlich nicht viel hinzufügen kann, und doch gewagt wird. Das Pathos dieser Augenblicke war stark und dafür verzieh man Fassbinder, dass seine Filme so vieles verweigerten. Keine Gewalt und kein Sex, auch die Schönheit eher behauptet als bewiesen. Dass Fassbinder mit solchen Filmen ein internationaler Star werden konnte war kaum wahrscheinlich. So unwahrscheinlich wie dass eine Pop-Sängerin mit Brille in die Charts kommt. [Dieser Text ist zuerst in französischer Übersetzung erschienen in: Trafic, Revue du cinéma, Nr.55, Automne 2005.] filmkritik, 5. Oktober 2005 um 13:46:03 MESZ ... Link ... Nächste Seite
|
online for 8862 Days
last updated: 10.04.14, 10:40  Youre not logged in ... Login

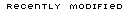 Danièle Huillet – Erinnerungen, Begegnungen
NICHT VERSÖHNT (1965) *** Jean-Marie Straub – Danièle und ich sind uns im November 1954 in Paris begegnet – wir erinnern uns gut daran, weil das der Beginn der algerischen Revolution war. Ich war mehrmals per Autostop nach Paris gekommen, um Filme zu sehen, die es bei uns nicht gab, LOS... by pburg (05.10.07, 11:58)
UMZUG
Nach knapp 2000 Tagen bei antville und blogger machen wir ab jetzt woanders weiter. Unter der neuen Adresse http://www.newfilmkritik.de sind alle Einträge seit November 2001 zu finden. Großer Dank an antville! Großer Dank an Erik Stein für die technische Unterstützung! by filmkritik (08.05.07, 15:10)
Warum ich keine „politischen“ Filme mache.
von Ulrich Köhler Ken Loachs „Family Life“ handelt nicht nur von einer schizophrenen jungen Frau, der Film selbst ist schizophren. Grandios inszeniert zerreißt es den Film zwischen dem naturalistischen Genie seines Regisseurs und dem Diktat eines politisch motivierten Drehbuchs. Viele Szenen sind an psychologischer Tiefe und Vielschichtigkeit kaum zu überbieten – in... by pburg (25.04.07, 11:44)
Nach einem Film von Mikio Naruse
Man kann darauf wetten, dass in einem Text über Mikio Naruse früher oder später der Name Ozu zu lesen ist. Also vollziehe ich dieses Ritual gleich zu Beginn und schreibe, nicht ohne Unbehagen: Ozu. Sicher, beide arbeiteten für dasselbe Studio. Sicher, in den Filmen Naruses kann man Schauspieler wiedersehen, mit denen... by pburg (03.04.07, 22:53)
Februar 07
Anfang Februar, ich war zu einem Spaziergang am späten Nachmittag aufgebrochen, es war kurz nach 5 und es wurde langsam dunkel, und beim Spazierengehen kam mir wieder das Verhalten gegenüber den Filmen in den Sinn. Das Verhalten von den vielen verschiedenen Leuten, das ganz von meinem verschiedene Verhalten und mein... by mbaute (13.03.07, 19:49)
Berlinale 2007 – Nachträgliche Notizen
9.-19. Februar 2007 Auf der Hinfahrt, am Freitag, schneite es, auf der Rückfahrt, am Montag, waren die Straßen frei und nicht übermäßig befahren. Letzteres erscheint mir angemessen, ersteres weit weg. Dazwischen lagen 27 Filme, zwei davon, der deutsche Film Jagdhunde, der armenische Film Stone Time Touch, waren unerträglich, aber sie lagen... by filmkritik (23.02.07, 17:14)
Dezember 06, Januar 07
Im Januar hatte ich einen Burberryschal gefunden an einem Dienstag in der Nacht nach dem Reden mit L, S, V, S nach den drei Filmen im Arthousekino. Zwei Tage danach oder einen Tag danach wusch ich den Schal mit Shampoo in meiner Spüle. Den schwarzen Schal hatte ich gleich mitgewaschen,... by mbaute (07.02.07, 13:09)
All In The Present Must Be Transformed – Wieso eigentlich?
In der Kunst / Kino-Entwicklung, von der hier kürzlich im Zusammenhang mit dem neuen Weerasethakul-Film die Rede war, ist die New Yorker Gladstone Gallery ein Global Player. Sie vertritt neben einer Reihe von Bildenden Künstlern, darunter Rosemarie Trockel, Thomas Hirschhorn, Gregor Schneider, Kai Althoff, auch die Kino-Künstler Bruce Conner, Sharon... by pburg (17.12.06, 10:44)
Straub / Huillet / Pavese (II)
Allegro moderato Text im Presseheft des französischen Verleihs Pierre Grise Distribution – Warum ? Weil : Der Mythos ist nicht etwas Willkürliches, sondern eine Pflanzstätte der Symbole, ihm ist ein eigener Kern an Bedeutungen vorbehalten, der durch nichts anderes wiedergegeben werden könnte. Wenn wir einen Eigennamen, eine Geste, ein mythisches Wunder wiederholen,... by pburg (10.11.06, 14:16)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||